WARUM SEHEN WIR DIE GEFAHR, DASS DAS LAND BERLIN AM GROSSEN TIERGARTEN KNABBERN KÖNNTE?
Die Historie zeigt, wie planlos, orientierungslos Parteien und einzelne Politiker mit dem Wohl der Berliner Bevölkerung in den letzten Jahrzehnten umgegangen sind.
Hier erfährst Du einige Hintergründe zur Begründung unseres Vorhabens:
INHALT
1. Der Berliner Haushalt
WIR WARNEN VOR MÖGLICHEN ENTWICKLUNGEN, BEDINGT DURCH DIE AKTUELLE UND ZUKÜNFTIGE FINANZLAGE BERLINS
Finanzlage Berlins
- Schuldenstand aktuell über 66 Mrd. Euro, zusätzlich ca. 78 Mrd. Euro Pensionslasten.
- Sanierungsstau bei Infrastruktur und öffentlichen Gebäuden erfordert laut einer Studie Investitionen von mindestens 108 Mrd. Euro in den nächsten zehn Jahren.
- CDU/SPD-Haushaltsentwurf 2025 sieht steigende Verschuldung auf ca. 76 Mrd. Euro bis 2027 vor.
Problematik:
- Wachsende Verschuldung schränkt zukünftige Handlungsspielräume massiv ein.
- Steigende Zinslasten führen zu weiterer Haushaltsbelastung.
- Gefahr mangelnder Generationengerechtigkeit.
Finanzierungsoptionen:
- Bundesmittel reichen nicht aus.
- Vorschläge wie Kapitalmarktfinanzierung (Anleihen, Public-Private-Partnerships).
Rückblick:
- ähnliche Modelle in den 1990ern führten zum Bankenskandal und hohen Verlusten für Berlin.
Warnung vor Wiederholungen:
- Erinnerung an Verkauf öffentlichen Eigentums („Tafelsilber“), besonders von Grundstücken.
Spekulative Befürchtung:
- zukünftige Regierungen könnten sogar den Großen Tiergarten für Bebauung freigeben, um Haushaltslöcher zu stopfen.
Fazit & Forderung:
- Dauerhafter Schutz des Großen Tiergartens muss gesichert werden.
- Ergänzung des Grünanlagengesetzes per Volksbegehren, um das Areal im Eigentum des Landes Berlin zu bewahren und Bebauung auszuschließen
AUS DER VERGANGENHEIT FÜR GEGENWART UND ZUKUNFT LERNEN
Aus der Vergangenheit für Gegenwart und Zukunft lernen
„Niemand hat die Absicht, den Großen Tiergarten zu bebauen!“
Wirklich niemand und niemals? Zweifel an der Glaubwürdigkeit von Politik und Verwaltung kommen auf, wenn man auf die aktuelle Haushaltspolitik blickt. Fakt ist, dass der Schuldenstand Berlins beachtlich ist.
„Zu den Schulden von über 66 Milliarden Euro kommen weiteren rund 78 Milliarden Euro für anstehende Pensionszahlungen sowie der immense Sanierungsrückstau an Infrastruktur und öffentlichen Liegenschaften.“(1) „Um allein diesen Sanierungsrückstau abzubauen sollten mindestens 108 Milliarden Euro in den kommenden zehn Jahren in die Sanierung und Modernisierung der öffentlichen Infrastruktur von Berlin investiert werden sollten“.
Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB), der Investitionsbank Berlin (IBB) und des Ostdeutschen Bankenverbandes, die am 3. April 2025, in Berlin vorgelegt wurde. Diese Summe sei nötig, um Straßen, Schienen, Brücken, Schulen, Universitäten, Wasser- und Wärmenetze, Digitalisierung und vieles mehr auf den aktuellen Stand zu bringen, heißt es.(2)
Wie diese Mammutaufgabe bei den stets leeren Kassen des Landes Berlin finanziert werden soll?
Einen Teil des fehlenden Geldes sollte Berlin aus dem milliardenschweren Investitionspaket des Bundes erhalten. Doch das reicht laut Studie bei Weitem nicht aus?
Noch mehr Schulden aufnehmen? Entsprechend des im Entwurf am 22.7.2025 vorgestellten Haushaltsentwurfs von CDU und SPD steigen die Schulden in 2026/2027 von derzeit 66 Milliarden Euro bis Ende 2027 auf rund 76 Mrd. Euro. „Die stark ansteigende Verschuldung nimmt Berlin für die Zukunft fast jede Gestaltungsmöglichkeit“, sagt dazu die Präsidentin des Berliner Rechnungshofs(3). „Mehr Schulden bedeuten auch steigende Zinslasten, die in künftigen Haushalten für laufende Staatsaufgaben fehlen werden.
Der Ruf nach noch mehr Schulden wird die unweigerliche Folge sein, um diese Löcher dann wieder stopfen zu können“, sagte Alexander Kraus vom Bund der Steuerzahler(4). Generationengerechtigkeit sieht anders aus.
Zehn Monate später titelt der Tagesspiegel „Hauptstadt droht Haushaltsnotlage – Verschuldung steigt auf Rekordhöhe“(5) Demnach steigt laut Stabilitätsbericht des Landes Berlin, vom 14. 10.2025, die Verschuldung pro Einwohner von derzeit 17.739 Euro auf 20.759 Euro im Jahr 2029.
Stefan Brandt, Vorstandsmitglied der landeseigenen Investitionsbank IBB, rät daher, Geld von Anlegern einzusammeln: „Ein sehr großer Teil unserer Bilanzsumme refinanzieren wir auf dem Kapitalmarkt. Das heißt, wir nehmen in der Tat Anleihen auf und haben unsererseits Investoren, die diese Anleihen zeichnen und uns damit Geld zur Verfügung stellen.“ Wir verkaufen also kein Tafelsilber, lobt sich Stefan Brandt(6).
Aber: Diese Art der Finanzierung („Public-Privat-Partnership“) probierten SPD und CDU bereits in den 90er aus: 1995 zeichnete sich ab, dass der Immobilienmarkt rückläufig war. Dennoch wurden weiterhin Mietgarantien von 25 Jahren auf Immobilienfonds gewährt, für die das Land Berlin die Haftung übernahm.
Es kam wie es kommen musste: Dass Finanzabenteuer endete im Jahr 2000 spektakulär im Bankenskandal (7) mit der Folge, dass das Land Berlin durch Beschluss des Abgeordnetenhauses Immobilienrisiken von bis zu 21,6 Milliarden Euro übernahm. Die durch den Skandal hochverschuldete Stadt gründete daraufhin den Liegenschaftsfonds (heute IBIM Berliner Immobilienmanagement GmbH) um neues Geld aufzutreiben:
Wieder wurde Berliner Tafelsilber verscherbelt, diesmal landeseigene Grundstücke. Insgesamt rd. 21 qkm, davon 85 % lukratives Bauland (8).
Blicken wir in die Kristallkugel!
Wären im Abgeordnetenhaus in Zukunft Mehrheiten denkbar, die in einer ähnlichen Situation eine „behutsame Bebauung“ der großen Wiesenflächen im Großen Tiergarten mit Punkthochhäusern oder mit Regierungsbauten in Erwägung ziehen könnten, um wieder mal Haushaltslöcher zu schließen? Alles Spekulation? Schwer zu sagen, aber im Rückblick auf die Landespolitik nicht unwahrscheinlich.
Fazit:
Einem solchen hypothetischen Irrweg gilt es jedenfalls dringend frühzeitig entgegenzutreten. Deshalb ist es im Sinne der Vorsorge erforderlich, schon hier und heute die notwendigen Entscheidungen zum dauerhaften und vollumfänglichen Erhalt des Großen Tiergartens zu treffen, um rechtzeitig gefährliche Entwicklungen in der Zukunft zu verhindern. Deshalb muss das Grünanlagengesetz per Volksbegehren jetzt um den dauerhaften Schutz des Großen Tiergartens im dauerhaften Eigentum des Lanes Berlin ergänzt werden.
(1) „Bund der Steuerzahler Berlin warnt vor Schuldenspirale“, , Alexander Kraus, in: Bund der Steuerzahler Berlin e. V. / Meldungen 14.03.2025
(2) „Studie beziffert Modernisierungskosten für Infrastruktur auf 108 Milliarden Euro“, Johannes Frewel, rbb24 Inforradio, 03.04.2025
(3) Abrechnung mit Senat „!Schulden nehmen Berlin jeden Freiraum“, Anna Thewalt,. Tagesspiegel vom 24.7.2025
(4) „Bund der Steuerzahler Berlin warnt vor Schuldenspirale“, Alexander Kraus, in: Bund der Steuerzahler Berlin e. V. / Meldungen 14.03.2025
(5) Hauptstadt droht Haushaltsnotlage“, von rk, Tagesspiegel 15. 10. 2025
(6) „Studie beziffert Modernisierungskosten für Infrastruktur auf 108 Milliarden Euro“, Johannes Frewel, rbb24 Inforradio, 03.04.2025
(7) Berliner Bankenskandal, Wikipedia
(8) „Ausverkauf – Die Privatisierung landeseigener Grundstücke in Berlin“, Florine Schüschke, in: Arch+, Heft 241, Seite 76ff
2. Vorschläge für zusätzliche
Steuereinnahmen und Abgaben
GELD FÜR DIE KLAMMEN KASSEN KANN AUCH WOANDERS HERKOMMEN – BEISPIELE GEFÄLLIG?
1. Einführung einer Wohnungs-Leerstandssteuer
- Ziel: Besteuerung leerstehender Wohnungen, wie in Vancouver (1 % des Immobilienwerts ab 180 Tage Leerstand).
- Steuerrechtlich auf Landesebene möglich.
- Ausnahmen: Krankheit, Sanierung, Eigentümerwechsel etc.
- Potenzial: ca. 1 Mio. Euro
2. Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes
- Berlin liegt mit 410 % weit unter dem Niveau anderer Großstädte (München: 490 %, Köln: 475 %).
- Anhebung auf 450 % würde Personengesellschaften zur Zahlung verpflichten.
- Kritik: Belastung der Wirtschaft, aber auch Notwendigkeit zur gerechten Finanzierung.
- Potenzial: ca. 300 Mio. Euro
3. Verbot bzw. Einschränkung von Share Deals mit Immobilien
- Umgehung der Grunderwerbsteuer durch Unternehmensbeteiligungen statt direktem Immobilienkauf.
- Auch als Mittel zur Geldwäsche problematisch.
- Bundesratsinitiative zur Schließung von Schlupflöchern geplant.
- Potenzial: ca. 100 Mio. Euro
4. Kostenbeteiligung bei Hochrisiko-Fußballspielen
- Berliner Proficlubs zahlen aktuell keine Kosten für Polizeieinsätze.
- Gerichtsurteil erlaubt Umlage auf Clubs – bisher nicht genutzt.
- Potenzial: ca. 3 Mio. Euro
5. Prüfung und ggf. Stopp von Groß- oder Prestigeprojekten
- Beispiele: Olympiabewerbung, Magnetschwebebahn, A100-Ausbau, U-Bahnprojekte.
- Keine direkte Zahlenangabe, aber Potenzial zur Kostenvermeidung.
- Radwege werden nicht als Großprojekte angesehen.
6. Einführung der Grundsteuer C
- Steuer auf leistungsfreien Wertzuwachs bei Grundstücken, etwa durch Umwidmung.
- Ziel: Aktivierung von Bauland und gerechtere Beteiligung an Infrastrukturwertsteigerungen.
- Potenzial: nicht konkret beziffert („+xx Mio.“)
7. Mehr Betriebsprüfer einstellen
- Mangelndes Personal führt zu weniger Steuerprüfungen und entgangenen Einnahmen.
- Großbetriebe zeigten besonders hohes Nachzahlungspotenzial.
- 2024: 430 Mio. Euro Steuern nacherhoben – Steigerung durch mehr Prüfungen möglich.
- Potenzial: ca. 100 Mio. Euro zusätzlich
8. Ausbau der Geschwindigkeitsüberwachung (Blitzer)
- Berlin hat zu wenige aktive Blitzer, viele sind außer Betrieb oder untergenutzt.
Personalmangel bei Bußgeldstelle verhindert Auswertung. - Frühere Zahlen zeigen deutlich, dass höhere Erträge möglich sind.
- Potenzial: bis zu 200 Mio. Euro jährlich
9. Anwohnerparken bisher das große Verlustgeschäft
- Verwaltungskosten (Ø 42,29 € pro Vignette) übersteigen den bisherigen Preis (20,40 €) deutlich, wodurch jährlich Millionendefizite entstehen.
- Andere Städte (Bonn 300 €, Münster 260 €, Freiburg 200 €, Köln bis 120 €) verlangen deutlich höhere Gebühren.
- SPD-Vorschlag zur Anhebung auf 120 € wurde von der CDU abgelehnt.
- Vorschlag von Andreas Knie: Alle Parkplätze im Berliner Innenstadtring kostenpflichtig machen und digital bewirtschaftet – mit marktgerechten, dynamischen Preisen, um Parksuchverkehr zu reduzieren und den Auto-Bestand in der Stadt spürbar zu senken.
Fazit
Diese wenigen Vorschläge zielen auf eine gerechtere Steuerpolitik, effizientere Ressourcennutzung und stärkere Beteiligung wohlhabender Akteure an der Finanzierung öffentlicher Aufgaben. Insgesamt könnten durch Umsetzung aller Maßnahmen mehrere hundert Millionen Euro jährlich zusätzlich für den Berliner Haushalt generiert werden – bei verbesserter sozialer Balance und mehr Transparenz.
In einer Pressemitteilung der Personalvertretung(1) der 145.000 Landesbeschäftigten vom 26.3.2025 wird kritisiert, dass es nicht angehen könne, dass nach wie vor die Gewinnung zusätzlicher Einnahmen nicht konsequent angegangen wird. Welche könnten das sein?
Steuern und Abgaben haben eine Lenkungsfunktion und helfen das Gemeinwesen in Gang zu halten.
Wir haben hier ein paar Ideen für zusätzliche Einnahmequellen für das Land aufgeführt, erstrebenswert wäre allerdings, einen Bürgerrat zu beauftragen, weitere Vorschläge zu sammeln.
(1) „Sparpolitik, scharfte Kritik der Personalräte, von Robert Kiesel Tagesspiegel vom 26.3.2025
UNSERE BEISPIELE FÜR ALTERNATIVE EINNAHMEN IM EINZELNEN
Der Stabilitätsbericht des Landes Berlin vom 14.10. 2025 weist darauf hin, „dass der negative Finanzierungssaldo(1) pro Einwohner deutlich über dem zulässigen Schwellenwert liegt. Im laufenden Jahr 2025 liegt der Wert bei minus 711 Euro pro Einwohner, zulässig wären minus 429 Euro pro Einwohner. Zum Vergleich: Im Schnitt aller 16 Bundesländer liegt der Finanzierungssaldo bei minus 229 Euro pro Einwohner Diesen Wert wird Berlin laut Prognose für das Jahr 2026 mit dann minus 786 pro Kopf deutlich überschreiten“ (2).
Wenn also die Ausgaben höher sind als die Einnahmen, warum erhöht das Land Berlin nicht die einnahmen?
In einer Pressemitteilung der Personalvertretung der 145.000 Landesbeschäftigten vom 26.3.2025 (3) wird ebenfalls kritisiert, dass es nicht angehen könne, dass nach wie vor die Gewinnung zusätzlicher Einnahmen nicht konsequent angegangen wird. Welche könnten das sein?
Steuern und Abgaben haben eine Lenkungsfunktion und helfen das Gemeinwesen in Gang zu halten. Hier unsere Liste mit zusätzlichen Einnahmequellen für das Land. Erstrebenswert wäre allerdings, einen Bürgerrat zu beauftragen, weitere Vorschläge zu sammeln.(9c)
1. Erhebung einer Wohnungs-Leerstandssteuer – jährliches Plus 1 Mio. Euro
Mehr Wohnraum durch Besteuerung von leerstehenden Immobilien: 40.000 Wohnungen standen in 2022 in Berlin leer(4) – Bei Leerstand einer Wohnung können – sofern eine Vermietungsabsicht nachgewiesen werden kann (Schaltung von Anzeigen, Renovierung, Beauftragung eines Maklers u.ä.) die Vermietungsverluste steuerlich geltend gemacht werden.
(Anmerkung der Verfasser: Es ist ein grundlegendes Prinzip des deutschen Steuerrechts bei der Einkommensermittlung aus Vermietung und Verpachtung, dass jede tatsächliche Einnahme und Ausgabe periodenbezogen, also nach dem tatsächlichen Zufluss und Abfluss in einem bestimmten Jahr berechnet wird, obwohl bei der wirtschaftlichen Kalkulation einer Miete ein temporärer Leerstand – also Verluste – bereits einkalkuliert wurde, der Mieter also Verluste bereits mit der Mietzahlung ausgeglichen hat.)
Bei der Errechnung der Miete ist bereits ein temporärer Leerstand mit eingepreist. Warum wird der Leerstand steuerlich als Verlust angesehen und vom Gewinn abgezogen?
Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages veröffentlichte am 13. September 2018 das folgende Ergebnis einer Anfrage aus der CDU/CSU-Fraktion:
1. Fragestellung
Die Auftraggeber möchten wissen, ob eine Steuer auf leerstehende Wohnimmobilien wie sie die kanadische Stadt Vancouver seit Kurzem erhebt, mit nationalem und EU-Recht vereinbar wäre. Gefragt wird auch, welche Steuerart hierfür einschlägig wäre. Ferner wird nach dem möglichen Steueraufkommen und den zu erwartenden Effekten gefragt.
2. Die Leerstandsteuer in Vancouver
Die kanadische Stadt Vancouver erhebt auf leerstehende Immobilien eine Steuer in Höhe von 1% des steuerpflichtigen Immobilienwerts.1 Die Steuerpflicht entsteht für Wohnungen, die mehr als 180 Tage im Jahr weder von den Eigentümern selbst noch von Mietern genutzt werden. Die Steuereinnahmen sollen in Projekte für bezahlbaren Wohnraum reinvestiert werden. Jeder Wohnungseigentümer in Vancouver muss jährlich eine Erklärung zur Nutzung seiner Wohnung abgeben. Nicht besteuert werden Wohnungen, die für mindestens sechs Monate vermietet oder für mindestens 180 Tage im Jahr als Zweitwohnsitz für ein Arbeitsverhältnis in Vancouver genutzt wurden. Weitere Ausnahmetatbestände bestehen für Fälle, bei denen der Leerstand von mehr als 80 Tagen durch
– eine Erkrankung mit Aufenthalt im Krankenhaus oder einer Pflegeeinrichtung,
– einen Todesfalls des Bewohners,
– eine eigentumsrechtliche Übertragung der Immobilie auf einen neuen Eigentümer oder
– eine zügige Sanierung verursacht wurde.
3. Unionsrechtliche Bewertung (Beitrag des Fachbereichs PE 6)
Aus unionsrechtlicher Sicht begegnet die Idee der mitgliedstaatlichen Einführung einer Leerstandsteuer im Grundsatz keinen Bedenken. Entscheidend wäre jedoch die konkrete Ausgestaltung einer solchen Steuer.(5)
4. Leerstandsteuer ist eine Aufwandsteuer mit örtlichem Bezug
„…..Aufwandsteuern sind Steuern auf das Halten bzw. den Gebrauch von Gütern und Dienstleistungen…… Zu den Aufwandsteuern wird beispielsweise die Zweitwohnungsteuer gezählt…..Eine Leerstandsteuer wäre daher als örtliche Aufwandsteuer umsetzbar.
Aus den o.g. Gründen sollten jedoch alltagstypische Leerstandsfälle wie Krankenhaus-aufenthalt oder Eigentümerwechseln von der Steuerpflicht ausgenommen werden.“6)
5. Leerstandssteuer auch für Büro- und Einzelhandelsflächen?
Ob die Leerstandssteuer auch auf leerstehende Büroflächen und Einzelhandelsflächen ausgeweitet werden darf, ist zu prüfen.
2. Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer – jährliches Plus 300 Mio. Euro
„Berlin verkauft sich zu billig.“ Das sagt jedenfalls Jörg Kühnold, der über 30 Jahre als Fachreferent in der Steuerabteilung der Finanzverwaltung gearbeitet hat.
Mit dem Hebesatz für die Gewerbesteuer, der seit 1999 konstant bei 410 liegt, bleibt Berlin weit unter dem Niveau von anderen deutschen Großstädten. Damit werden Gewinne großer Kapital-gesellschaften subventioniert und Personengesellschaften und Einzelunternehmen völlig von der Gewerbesteuer freigestellt.
Zum Vergleich die Hebesätze für die Gewerbesteuer anderer Städte: Er liegt in München bei 490 Prozent, in Köln bei 475 Prozent, in Hamburg bei 470 Prozent, in Düsseldorf bei 440 Prozent und in Stuttgart bei 420 Prozent. Wenn Berlin die Gewerbesteuer um 40 Hebesatzpunkte auf 450 Prozent anheben würde, wären dies 300 Millionen Euro Mehreinnahmen im Jahr. Zudem würde man in die Nähe der durchschnittlichen Gewerbesteuerhebesätze von anderen größeren Städten in Deutschland kommen.
Der außerordentlich niedrige Hebesatz Gewerbesteuer in Berlin hat zur Folge, dass für Personengesellschaften (GbR) und Einzelunternehmen eine fast vollständige Entlastung von der Gewerbesteuer erfolgt (§ 35 Einkommensteuergesetz). Die vollständige Entlastung erfolgt bis zu einem Hebesatz von 400 Prozent. Es ist schlicht und einfach nicht akzeptabel, dass die Gewerbesteuer in Berlin bundesweit am untersten Rand festgelegt ist und zugleich vom Senat eine rigorose Sparpolitik betrieben wird, die das Leben vieler Menschen in Berlin verschlechtert.
Berlin darf nicht nur von der arbeitenden Bevölkerung finanziert werden (Lohnsteuer, Umsatzsteuer, Mineralölsteuer). Es ist notwendig, die Gewerbesteuer in Berlin auf das Durchschnittniveau der Hebesätze von Großstädten anzuheben. Die Ausschöpfung der einen Steuerquellen des Landes Berlin ist aber auch eine Verpflichtung im Rahmen es bundesstaatlichen Finanzausgleichs: Berlin ist der größte Zuwendungsempfänger, schöpft aber die einen Gewerbesteuerquellen nicht aus.“(7)
Klingt überzeugend? Nicht für die Finanzverwaltung! „In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage dürfen die Unternehmen nicht noch weiter finanziell und bürokratisch belastet werden“, schreibt ein Sprecher dem Checkpoint. Die Konstanz des Hebesatzes für die Gewerbesteuer – der Wert gilt seit 1999 unverändert – verschaffe der Berliner Wirtschaft „verlässliche Planungssicherheit“(8).
3. Verbot von Share Deals mit Immobilien – jährliches Plus 100 Mio. Euro
2021 übernahm der größte Immobilienkonzern Europas, die Vonovia AG, ihren unmittelbaren Konkurrenten, die Deutsche Wohnen SE, Eigentümerin von 161.000 Wohnungen im Gesamtwert von 18 Mrd. Euro. Um die dafür fällige Grunderwerbssteuer(9) in Höhe von rd. 1 Mrd. Euro an das Land Berlin nicht zahlen zu müssen, bediente sich die Vonovia eines legalen Steuertricks: des „Share Deals“.(10)
Bei einem Share Deal wird nicht eine Immobilie gekauft, sondern eine Beteiligung an einer Gesellschaft, die diese Immobilie hält.
Ursprünglich ein Geheimtipp, wurden Share Deals ab den 1990er-Jahren zunehmend von großen Immobilienunternehmen genutzt. Um dem entgegenzuwirken, führte der Gesetzgeber 1997 eine Besteuerung ab einer Beteiligung von 95 % ein. Diese Regelung ließ jedoch Schlupflöcher offen – etwa durch das RETT-Blocker-Modell, bei dem 94,9 % durch eine Muttergesellschaft und die restlichen Anteile durch eine Tochtergesellschaft übernommen wurden.
Erst 2021 folgten Verschärfungen: Die Grenze wurde auf 90 % gesenkt und die Sperrfrist auf 10 Jahre verlängert. Schätzungen gehen davon aus, dass dem Land Berlin immer noch jährlich rd. 100 Millionen Euro Grunderwerbssteuer auf diese Art und Weise verloren gehen.(11)
Share Deals machten vor dem Jahr 2024 in Berlin bis zu 31 Prozent der Transaktionen aus.(12) Der Share Deal bleibt damit – trotz Gesetzesänderungen – ein attraktives Steuersparmodell für große Konzerne.
Dies sorgt auch weiterhin für Kritik, weil private Käufer keine vergleichbaren Möglichkeiten haben.
Zudem sind Share Deals attraktiv für Geldwäsche:
Firmenanteile können über Briefkastenfirmen, Treuhänder oder verschachtelte Unternehmensstrukturen in Offshore-Staaten gehalten werden und verwischen so Eigentümerstrukturen.
Dadurch ist oft unklar, wer wirklich hinter dem Kauf steckt (wirtschaftlich Berechtigter).
Share Deals unterhalb gewisser Schwellen (z. B. unter 90 % bei Immobilien in Deutschland) lösen keine Grunderwerbsteuer aus und werden nicht in Registern wie dem Grundbuch direkt sichtbar und unterliegen nicht der automatischen Geldwäscheprüfung, wie sie bei Banken oder Notaren beim direkten Immobilienkauf greift.
Immobilien- oder Unternehmenswerte können Millionen kosten.
Share Deals ermöglichen es, große Summen in einem Schritt zu transferieren und dabei den Ursprung des Geldes zu verschleiern.
Im Gegensatz zu klassischen Banktransaktionen stehen viele Share Deals nicht unter direkter Kontrolle der Finanzaufsicht, insbesondere wenn sie im Ausland oder mit ausländischen Firmen stattfinden.
Wird ein Anteil an einer scheinbar seriösen Firma gekauft, wirkt der Deal auf den ersten Blick wie eine normale Investition – selbst wenn er in Wahrheit nur der Geldwäsche dient.
Beispiel: Eine kriminelle Organisation erwirbt über eine Offshore-Firma 89,9 % der Anteile an einer GmbH, die ein großes Immobilienobjekt in Berlin besitzt.
Der eigentliche Geldgeber bleibt anonym.
Es fällt keine Grunderwerbsteuer an.
Kein Notar muss eingeschaltet werden.
Das illegale Geld ist nun „investiert“ in deutsches Betongold – scheinbar sauber.
Die Einführung des Transparenzregisters in Deutschland zur Offenlegung wirtschaftlich Berechtigter im Jahr 2021 war ein wichtiger Schritt, um in diese Grauzonen mehr Licht zu bringen, aber Umgehungsmöglichkeiten bleiben. Die schwarz-rote Koalition in Berlin würde das Steuerschlupfloch gerne schließen, so wie schon viele andere vor ihr. Sie strebt dazu eine Bundesratsinitiative an, mit dem Ziel, Share Deals zu untersagen oder zumindest einzuschränken. Hoffentlich diesmal nicht nach dem Motto: „Es muss sich was ändern, damit alles beim Alten bleibt“. Jedenfalls ist dringender Handlungsbedarf geboten, um weitere Einnahmen für das Land Berlin zu erschließen. Andernfalls kann der Fall eintreten, dass der Große Tiergarten tatsächlich ganz oder teilweise veräußert wird, um mit dem Verkaufserlös Haushaltslöcher zu stopfen.
4. Gebühren für teure Hochrisiko-Fußballspiele – jährliches Plus 3 Mio
Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) lehnt es ab, die Berliner Proficlubs an den Mehrkosten für Polizeieinsätze bei Hochrisiko-Fußballspielen zu beteiligen. Und das, obwohl ein Urteils des Bundesverfassungsgerichts die Länder ermächtigt, solche Kosten an die Vereine weiterzugeben.
Bremen hatte 2015 der Deutschen Fußball Liga (DFL) erstmals 400.000€ für die Kosten des Polizeieinsatzes bei einem Hochrisikospiel in Rechnung gestellt. Nicht für die gesamten kosten des Polizeieinsatzes, sondern lediglich für den Mehraufwand, der nötig war, gewaltbereite Fans in Schach zu halten.
Und Berlin mit dem Erstligist Union und dem Zweitligistclub Union?
Seit 2018 gab es in Berlin 49 Hochrisikospiele – davon 19 bei Union und 15 bei Hertha und 12 bei Viertligist BFC Dynamo. Den Mehraufwand für die Polizei begleicht das Land Berlin, also die SteuerzahlerInnen. Ist denn ausreichend Geld für die Polizeiarbeit vorhanden? Wohl kaum: „Am stärksten zu leiden unter dem Sanierungsstau haben der Auflistung des Senats zufolge Wachen, Abschnitte und andere Gebäude der Polizei, deren Wiederherstellung allein fast eine Milliarde Euro kosten würde.“(13) „Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt!“ und der Weg geht leider in der Politik immer nur bis zum nächsten Wahltermin. Landzeitkonzepte sind bei so einer Denkweise von der Politik folglich kaum zu erwarten.
5. Grundsätzlich alle Groß- oder Prestigeprojekte auf den Prüfstand stellen!
Olympiabewerbung, Magnetschwebebahn, U-Bahnausbau, A100 etc.
Radwege sind übrigens keine Groß- oder Prestigeprojekte!
6. Einführung der Grundsteuer C
„Was ist die neue Grundsteuer C ?
„Insbesondere in Ballungsgebieten besteht ein erheblicher Wohnungsmangel. Die damit verbundene Entwicklung der Werte der Grundstücke wird vermehrt dazu genutzt, baureife Grundstücke als Spekulationsobjekt zu halten. Grundstücke werden teilweise nur aufgekauft, um eine Wertsteigerung abzuwarten und die Grundstücke anschließend gewinnbringend wieder zu veräußern. Diese Spekulation mit Bauland verhindert, dass dringend benötigter Wohnraum entsteht. Auch dieses Problem wurde mit der Reform der Grundsteuer angegangen. Künftig können Gemeinden für baureife, aber unbebaute Grundstücke einen höheren Hebesatz festlegen, wenn auf diesen keine Bebauung erfolgt. Diese sogenannte Grundsteuer C verteuert damit die Spekulation und schafft finanzielle Anreize, auf baureifen Grundstücken tatsächlich auch Wohnraum zu schaffen“ (14)
Dass so eine gemeinwohlorientierte Steuer wirtschaftsnahen Verbänden, Parteien und Instituten Kritik hagelt, muss nicht sonderlich überraschen. Dazu unser Aufruf:
Spekulanten schonen, Grünflächen opfern: SPD und CDU blockieren Grundsteuer C“
Die Berliner SPD zeigt mit Steffen Krach und Christian Gaebler, wie Politikverdrossenheit entsteht: Volksentscheide werden relativiert, Bürgerdialoge entwertet, wirksame Instrumente blockiert.
Zum Volksentscheid Deutsche Wohnen & Co enteignen erklärte Krach: „Kein Unternehmen muss Angst haben, enteignet zu werden. Auch beim Volksentscheid Tempelhofer Feld sieht er keine Bindung – eine Randbebauung will er ausdrücklich nicht ausschließen“(15). Damit entwertet er das stärkste Instrument direkter Demokratie.
Bausenator Gaebler erklärte die Dialogwerkstätten zum Tempelhofer Feld gleich selbst zu Formaten „ohne Entscheidungswirkung“. Obwohl die große Mehrheit der ausgelosten Bürger:innen eine Bebauung ablehnte, behauptete er am Ende, Bürger:innen und Senat seien sich einig, „das Feld zu entwickeln“. Bürgerbeteiligung wird so zur Farce.
Besonders widersprüchlich ist das Vorgehen bei der Grundsteuer C: Dieses Instrument könnte Spekulanten zwingen, ihre versiegelten, längst erschlossenen Grundstücke endlich für Wohnungsbau zu aktivieren. Doch CDU und SPD blockieren, offenbar aus Angst vor ihrem Klientel, dem einflussreichen Eigentümerverband Haus & Grund. Stattdessen geraten öffentliche Grünflächen wie das Tempelhofer Feld immer stärker unter Druck, weil politisch lieber an Natur- und Freiflächen herangegangen wird, als Spekulanten in die Pflicht zu nehmen.
Dabei ist die Grundsteuer C keineswegs ein neues oder radikales Instrument. In Deutschland wurde sie, damals als „Bodenwertzuwachssteuer“ bekannt, bereits von etwa 1900 bis 1944 erhoben – mit Sätzen zwischen 10 und 30 Prozent des Veräußerungserlöses. Die Einnahmen flossen den Gemeinden zu. Ziel war und ist es, Spekulationen zu verhindern, Boden frühzeitig für die Bebauung zu mobilisieren und soziale Gerechtigkeit herzustellen. Denn Wertsteigerungen von Grundstücken entstehen in den meisten Fällen nicht durch Leistungen der Eigentümer:innen, sondern durch öffentliche Investitionen – etwa durch neue Bebauungspläne, Straßen, Parks oder Naherholungsflächen. Wenn also Ackerland zu Bauland wird, steigt der Bodenwert sprunghaft – ein leistungsfreier Gewinn, der zu großen Teilen der Allgemeinheit zuzuschreiben ist.
Dass eine solche gemeinwohlorientierte Steuer wirtschaftsnahen Verbänden, Parteien und Instituten nicht gefällt, überrascht nicht. Doch es ist ein Skandal, wenn eine demokratisch gewählte Regierung sich mehr den Interessen von Lobbyorganisationen verpflichtet fühlt als dem Gemeinwohl und den Volksentscheiden der Bürger:innen. Die cleveren Hamburger:innen haben die Steuer geingeführt und nutzen dau nach eigenen Angaben geoanalytische Programme, „um den Prüfvorgang so weit wie möglich digitalzu automatisieren und damit menschlichen Prüfbedarf zu verringern.“ Tagesspiegel vom 15.9.25 von DAniel BöldtWir fordern: Respektiert die Volksentscheide, aktiviert Bauland durch die Grundsteuer C – und schützt die Grünflächen dieser Stadt!
7. Mehr Betriebsprüfer – jährliches Plus 100 Mio.
Wieder mal in Berlin eingekauft in Geschäften mit offener Kassenlade? Das könnte ein Fall für eine Betriebsprüfung werden. Berliner Betriebsprüfer haben 2024bei Kontrollen von Berliner Unternehmen rund 430 Millionen Euro zu wenig gezahlte Steuern eingetrieben.
„Am höchsten war demnach bei der Einkommenssteuer der Betrag, den die Firmen zu wenig an den Fiskus gezahlt hatten. Insgesamt addierte sich diese Summe auf 154 Millionen Euro. Bei der Gewerbesteuer mussten die Betriebe 90 Millionen Euro nachzahlen, bei der Körperschaftssteuer 82 und der Umsatzsteuer 63 Millionen Euro.
Dabei hätte der Betrag möglicherweise noch deutlich höher liegen können. Insgesamt kontrollierten die Finanzämter gut 8800 Betriebe in der Stadt. Je nach Unternehmensgröße fanden allerdings nur wenige Prüfungen statt.
So wurde nur ein Prozent aller Kleinstbetriebe untersucht. Bei den durchgeführten 3758 Prüfungen stießen die Kontrolleure allerdings unter anderem auf mehr als 36 Millionen zu wenig gezahlte Einkommenssteuer.
Noch mehr dürfte für die Stadt wohl bei Großbetrieben zu holen sein.
Die Steuerprüfer untersuchten 1257 Firmen und damit 16,3 Prozent aller Unternehmen dieser Größenklasse. Die dabei entdeckten knapp 229 Millionen Euro zu wenig gezahlte Steuern machen insgesamt mehr als die Hälfte der festgestellten Extra-Steuern aus.
Der Personalmangel belastet Arbeit der Berliner Steuerfahnder: Dass die Finanzämter nicht intensiver kontrollieren, liegt allerdings auch am fehlenden Personal. Im vergangenen Jahr waren im Land Berlin noch 563 Betriebsprüferinnen und -prüfer im Einsatz. Noch 2018 waren mit 653 fast einhundert Fachkräfte mehr für das Land im Einsatz, um zu wenig gezahlte Steuern einzutreiben. Entsprechend lag auch die Zahl der Betriebsprüfungen mit 10.000 deutlich höher.“(16)
8. Aufstellung von Blitzern zur Geschwindigkeitsmessung – jährliches Plus 200 Mio. Euro
„Trotz Einnahmen in Millionenhöhe: Senat verzichtet auf zusätzliche Blitzer – wegen Geldmangel“, titelt der Tagesspiegel am 22.4.2025.
Obwohl 46 stationäre (von denen 7 nicht im Betrieb sind) und 63 mobile Blitzer Einnahmen in Millionenhöhe generieren, wird der Berliner Senat in diesem Jahr keine zusätzlichen Blitzer anschaffen. „Für eine Erweiterung des Gerätebestands sind derzeit keine Finanzmittel eingeplant“, heißt es in einer Antwort der Innenverwaltung auf eine Anfrage der Grünen-Politiker Antje Kapek und Vasili Franco, die dem Tagesspiegel vorliegt.
Zudem fehlt es an Personal, weshalb die mobilen Messgeräte im Durchschnitt nur anderthalb Stunden täglich im Einsatz sind. Einnahmen wurden damit in Höhe von 33,4 Millionen Euro erzielt.
Das Geld kommt dem gesamten Landeshaushalt zugute und fließt nicht direkt zurück ins Innenressort. Die Einnahmen könnten noch wesentlich höher liegen.
„Obwohl es mehr Blitzersäulen gibt: Berlin verschickt 76 Prozent weniger Bußgeldbescheide an Raser. Im Jahr 2019 wurden 450.000 Tempoverstöße an den stationären Blitzersäulen geahndet. 2023 waren es nur noch 107.000. Warum ist das so?“
Der Hauptgrund scheint folgender zu sein: Die Bußgeldstelle gilt seit Jahren als überlastet. Jedes Jahr verjähren Zehntausende Geschwindigkeitsverstöße.(17)
Bereits Anfang 2023 hatte Spranger – damals noch als Innensenatorin eines rot-grün-roten Senats – 60 neue Blitzer bis 2026 angekündigt. Doch dieses Ziel liegt in weiter Ferne. Seit 2023 hat sich der Bestand der stationären Blitzer lediglich um zehn Geräte erhöht, zusätzliche mobile Blitzer wurden in dieser Zeit nicht angeschafft. Dabei refinanzieren sich Blitzer von selbst, wenn ausreichend Personal dafür eingestellt ist und sie dann auch wirklich genutzt werden.(18)
Insgesamt könnten Blitzer dann als 200 Millionen jährlich in die Berliner Landeskassen spülen, wenn die Politik das wollte. Profitieren könnten Schulen, Jugendzentren, Bildungszentren, die forensische Klinik sowie Feuer- und Polizeiwachen, um nur einige „Baustellen“ zu benennen.
9. Anwohnerparken bisher das große Verlustgeschäft(19)
Bisher gibt es in Berlin (wie auch in vielen anderen Städten) getrennte Anwohnerparkzonen, in denen Anwohner:innen günstiger oder kostenlos parken dürfen, während Nichtanwohner:innen meist höhere Gebühren zahlen oder gar nicht parken dürfen. Selbstverständlich sollte so ein System zumindest kostendeckend sein.
Ist es aber nicht: Liegt der Preis für eine Anwohnerparkvignette seit 2008 bei 20,40 Euro, stiegen die Verwaltungskosten auf in diesem Jahr „im Median auf 42,29 Euro“, heißt es im in einem Bericht der Verkehrsverwaltung an das Abgeordnetenhaus im Zuge der Haushaltsberatungen 2025 ff. Angewandt auf die 80.390 Vignetten, die die Bezirke allein von Januar bis Juli 2025 ausgestellt haben, summieren sich die ungedeckten Kosten der Verwaltung auf einen Millionenbetrag. Was aber ist ein sinnvoller und politisch durchsetzbarer Preis? In anderen deutschen Großstädten wurden die Preise in den vergangenen Jahren teils massiv angehoben. In Bonn liegt der Preis bei 300 Euro. In Münster kostet die Vignette 260 Euro, in Freiburg 200 Euro und in Köln bis zu 120 Euro – pro Jahr. Und Berlin? Die SPD hatte in den Haushaltsberatungen 2024 einen Preis für Anwohnerparkvignette von 120 €uro eingebracht, der von der CDU abgelehnt wurde. Man arbeite nun, so die Verkehrsverwaltung, an einem umfassenden Konzept. Passiert ist bisher nichts.
Der Verkehrsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin Knie schlägt ein radikales Konzept vor: Die Trennung von Anwohnerparken und Nicht-Anwohnerparken komplett abzuschaffen und alle Stellplätze im Berliner S-Bahnring kostenpflichtig und für alle zugänglich zu machen — aber zu einem einheitlichen, marktgerechten dynamischen Preis. Davon, dass eine derartige Erhöhung und Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung die Zahl der zugelassenen Autos in der Stadt reduzieren würde, ist Knie überzeugt. Er erklärte: „Eine spürbare Gebührenerhöhung könnte eine große Menge von Autos einfach verschwinden lassen, ganz einfach weil die Leute bei höheren Kosten ihr Auto abschaffen. Denn viele Menschen halten ihr Auto lediglich als ‚Mobilitätsreserve’ vor, weil das Parken ja nichts kostet.“
10. Bußgelder gegen Mietwucher
„Anfang Oktober 2025 hat mit Friedrichsberg-Kreuzberg zum ersten Mal ein Berliner Bezirk ein rechtskräftiges Bußgeld gegen eine Vermieterin durchgesetzt, weil die eine Wuchermiete verlangt hatte. Damit muss sie auf Verlangen nicht nur mehr als 22.000 Euro unrechtmäßiger Mieteinnahmen an ihre Mieterin zurückzahlen, sondern auch 26.000 Euro Strafe.
Doch Anfragen des Tagesspiegels bei anderen Bezirken ergaben: Zwar haben Mieter:innen auch ihnen teils Hunderte Fälle möglicher Wuchermieten gemeldet. Doch den Bezirken fehlt es nach eigener Aussage an Personal und Mitteln, um diese zu prüfen. Denn nur weil eine Miete deutlich über dem Üblichen liegt, verstößt sie noch nicht automatisch gegen das Wirtschaftsstrafgesetz (§ 5 WiStG). Und so bleiben Konsequenzen für viele wuchernde Vermieter:innen weiter aus.
Doch bei Hunderten möglicher Verstöße und Bußgeldern von gesetzlich bis zu 50.000 Euro – würde es sich nicht trotz leerer Kassen schnell auszahlen, mehr Fälle zu verfolgen? So hatte zuletzt im Stadtentwicklungsausschuss die Grünen-Abgeordnete Katrin Schmidberger argumentiert und gefragt, was das Land Berlin mit den Bußgeldern plane. Eine Anfrage des Tagesspiegels bei der Senatsverwaltung für Finanzen hat nun ergeben, dass die Bußgeldeinnahmen aus dem § 5 WiStG tatsächlich nicht in die Landeskasse fließen, sondern vollständig bei den Bezirken bleiben – zumindest vorläufig .
Das ändert sich allerdings im Jahr 2027: Von da an treiben zwar weiter die Bezirke die Bußgelder ein, die Einnahmen sollen dann aber formal in den Landeshaushalt fließen, ohne zunächst an einen speziellen Zweck wie eine Mietprüfstelle gebunden zu sein. Laut Senatsfinanzverwaltung werden sie anschließend über die Bezirke verteilt. Die Bezirke profitieren also nicht mehr direkt davon, wie viele Bußgelder sie selbst verhängen“ (20) .
„Der designierte SPD-Spitzenkandidat für die Berlin-Wahl 2026, Steffen Krach, fordert drei Wochen nach Veröffentlichung des o.g. Tagesspiegel-Artikels eine „Spezialeinheit Wohnraumschutz“. Diese soll nach seinen Vorstellungen die Bezirke dabei unterstützen, bestehende Gesetze und Regeln zum Schutz von Mietern besser durchzusetzen. „Hier sind die Bezirke zuständig, nur wir dürfen sie mit dieser Herkulesaufgabe nicht allein lassen“, sagte Krach der Deutschen Presse-Agentur. „Denn es fehlt dort oftmals schlicht an Kapazitäten.“ Deshalb wolle er den zwölf Bezirken die „Spezialeinheit“ zur Seite stellen, die sie mit rechtlicher Beratung, bei Bescheiden und in gerichtlichen Verfahren unterstützen soll (21).
Der Berg bewegt sich und gebar eine Maus: Es ist sicherlich Erfolg versprechender, wenn jeder Bezirk auf eigene Rechnung tätig wird und dann selber über die Verwendung der Bußgelder entscheiden kann. Denn: Der finanzielle und personelle Aufwand für die Bezirke lohnt sich auf Dauer nur dann, wenn sie auch unmittelbar am finanziellen Ergebnis beteiligt sind.
Wer hingegen Mietwucher nicht konsequent verfolgen will, der bildet am besten auf Landesebenen – oder noch besser auf Bundesebene – „Spezialeinheiten“.
Fazit:
Hunderte Millionen Euro jährlich könnten so in den Berliner Haushalt fließen – gerecht, effizient, nachhaltig. Es geht. Wenn man es will.
(1) Ein negativer Finanzierungssaldo pro Einwohner bedeutet, dass die Ausgaben des Landes Berlin höher sind als seine Einnahmen. Das Ergebnis ist ein Defizit, das pro Einwohner umgerechnet wird. Ein negativer Finanzierungssaldo pro Einwohner zeigt also, dass das Land Berlin mehr Geld ausgibt, als er einnimmt, und sich entsprechend verschulden muss.
(2) „Hauptstadt droht Haushaltsnotlage“, von rk, Tagesspiegel vom 15.10.2025
(3) Sparpolitik, scharffe Kritik der Personalräte“, von Robert Kiesel, tagesspiegel vom 26.3.2025
(4) „Zensus 2022 – Trotz Wohnungsnot in Berlin: 40.000 Wohnungen stehen leer“ Morgenpost vom 04.07.2024 und: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/mikrozensus-wohnraum-leerstand-100.html
(5) https://www.bundestag.de/resource/blob/579568/a0610021144843a562dd02fda3fbd68e/WD-4-128-18-pdf-data.pdf
(6) ebenda
(7) Berlin nutzt Potenzial für Mehreinnahmen nicht“, Jörg Kühnold, Diplom-Finanzwirt, Steuerberater in Tagesspiegel vom 1. März 2025
(8) „Geringer als in anderen Großstädten: Ist die Gewerbesteuer in Berlin zu niedrig?“ in: Tagesspiegel Checkpoint 27.2.2025
(8) In Berlin 6 Prozent vom Kaufpreis
(10) „Vonovia zahlt keine Dummensteuer – Bei der geplanten Übernahme der Deutschen Wohnen fällt keine Grunderwerbssteuer an. Per Steuerschlupfloch will Vonovia eine Milliarde Euro sparen.“, Von Gareth Joswig, Tageszeitung vom 2.7.2021
(11) „Share-Deal-Steuerlücke kostet Millionen: Bei vielen Immobiliengeschäften geht Berlin immer noch leer aus 100 Millionen Euro jährlich entgehen Berlin durch Share Deals. Nun zeigen Linken-Anfragen, dass in Berlin besonders oft Immobilien so gekauft werden.“ von Ralf Schönball, Tagesspiegel, 27.10.2021
(12) „Keine Grunderwerbssteuer fällig Vonovia nutzt bei Übernahme der Deutsche Wohnen Steuerschlupfloch“, rbb24 Inforadio, 12.10.2024
(13) „Landeseigene Liegenschaften: Der Berliner Drei-Milliarden-Sanierungsstau“, Ralf Schönball in:Die Sanierung der öffentlichen Bauten Berlins kommt nicht voran. Die Grünen sehen die Ursache bei der Landesfirma BIM.Von Ralf Schönball Tagesspiegel, 15.05.2018, 11:51 Uhr
(14) „Fragen und Antworten zur neuen Grundsteuer“, Bundesfuinbanzministerium vom 27.5.2024
(15) „Da fühle ich mich als Vater von drei Kindern verarscht“: SPD-Spitzenkandidat Krach kritisiert Verkehrspolitik des Berliner Senats
Von Daniel Böldt, Christian Latz, Anna Thewalt, in: Tagesspiegel vom 11.09.2025, 18:00 Uhr
(16) „Zu wenig gezahlte Steuern: Berlin treibt bei Betriebsprüfungen 430 Millionen Euro ein“, Christian Latz, Tagesspiegel vom Stand: 11.03.2024
(17) „Obwohl es mehr Blitzersäulen gibt…“, von Jörn Hasselmann, Tagesspiegel vom 27.03.2024
(18) „Trotz Einnahmen in Millionenhöhe: Senat verzichtet auf zusätzliche Blitzer – wegen Geldmangel“, von Daniel Böldt, Tagesspiegel, 22.04.2025
(19) Anwohnerparken in Berlin: Mehrheit lehnt höhere Gebühren ab“ von Robert Kiesel in: Tagesspiegel, 02.09.2025 und: „Kosten für Verwaltung sind viel höher als Einnahmen: Berlin macht Millionenverlust mit Anwohnerparkausweisen“, von Christian Latz, in Tagesspiegel vom 13.10.2025
(20) „Strafen für Vermieter von bis zu 50.000 Euro: Wer bekommt die Mietwucher-Bußgelder? Berliner Mieter haben Hunderte Fälle mögliche Wuchermieten gemeldet. Viele Bezirke sagen, ihnen fehlen die Mittel, sie zu verfolgen. Dabei winken Bußgelder.“ Von Jana Gäng, in Tagesspiegel, Stand: 21.10.2025,
(21) „Kampf gegen hohe Mieten in Berlin: SPD-Spitzenkandidat Krach fordert „Spezialeinheit Wohnraumschutz“, in: Tagesspiegel vom 17.10.2025
3. Landeseigene Wohnungsgesellschaften
NICHT AN MORGEN DENKEN HAT TRADITION
Landeseigene Wohnungen in Berlin: Vom Ausverkauf zur Rückeroberung?
1990 verwalteten die landeseigenen Berliner Wohnungsbaugesellschaften rund 600.000 Wohnungen. Bis 2010 schrumpfte der Bestand auf nur 270.000 – ein Verlust von 320.000 Wohnungen.
Wie kam es dazu?
- Restitution: 52.000 Wohnungen mussten an Alteigentümer:innen oder deren Erbinnen zurückgegeben werden – Folge des Einigungsvertrags. Viele dieser Häuser wurden rasch an Investoren weiterverkauft.
- Altschuldenregelung: 46.000 Wohnungen wurden infolge einer Konstruktion verkauft, nach der DDR-Staatsschulden als reale Verbindlichkeiten umgedeutet wurden. Kommunale Wohnungsunternehmen mussten zur Schuldentilgung Bestände privatisieren.
- Haushaltsfinanzierung: Ab 1995 wurden 122.000 Wohnungen im Zuge der „Vermögensaktivierungspolitik“ verkauft. Die Erlöse dienten der Haushaltskonsolidierung. Die Wohnungsunternehmen mussten Kredite aufnehmen, um diese Verkäufe zu finanzieren – ein Haushaltstrick mit teuren Folgen.
- GSW-Privatisierung: 2004 wurde die GSW (67.000 Wohnungen) für 2 Mrd. Euro an ein Finanzkonsortium verkauft. Später übernahm Deutsche Wohnen die GSW – 2021 dann Vonovia. Auch die GEHAG (34.000 Wohnungen) wurde übernommen.
Wiederaufbau des Bestands
Seit 2010 wurden rund 96.000 Wohnungen zurückgekauft, finanziert ohne Zuschüsse des Landes:
- 2019 kaufte Gewobag 6.000 Wohnungen für 920 Mio. €
- 2021 kauften HOWOGE, Degewo und Berlinovo 14.750 Wohnungen für 2,46 Mrd. €
- 2024 erwarb HOWOGE weitere 4.500 Wohnungen für 700 Mio. €
Diese Wohnungen waren einst für je rund 30.000 € verkauft worden – nun lagen die Rückkaufpreise bei über 150.000 € pro Wohnung. Die Gewinne der Verkäufer sind nach 10 Jahren steuerfrei – ein systemisches Problem.
Finanzielle Folgen
Die Rückkäufe erfolgten kreditfinanziert. Insgesamt belaufen sich die Schulden der sechs großen landeseigenen Wohnungsunternehmen auf rund 17 Milliarden Euro. Besonders verschuldet ist die Gewobag mit 5 Mrd. € und nur 10 % Eigenkapitalquote. Ausbaden müssen diese Finanzierungsakrobatik die MieterInnen der landeseigene Wohnungen durch beständig steigende Mieten.
Fazit
Die Berliner Wohnpolitik erlebte eine Achterbahnfahrt: Vom massiven Verkauf landeseigener Wohnungen zur teuren Rückgewinnung. Heute gehören wieder etwa 366.000 Wohnungen dem Land. Ziel der aktuellen Regierung: 500.000 Wohnungen.
Doch die Erfahrungen zeigen: Landeseigene Wohnungen sind politisch steuerbar – oft zulasten der Mieter:innen. Dauerhaft bezahlbarer Wohnraum gelingt langfristig eher durch gemeinwohlorientierte Träger wie Genossenschaften, die wirtschaftlich stabil agieren und demokratische Mitsprache ermöglichen.
DIE GESCHICHTE DER LANDESEIGENEN WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFTEN IM DETAIL
(21)Aus der Vergangenheit für Gegenwart und Zukunft lernen
„Niemand hat die Absicht, Grünanlagen zu bebauen!“ Wirklich niemand und niemals? Zweifel an der Glaubwürdigkeit von Politik und Verwaltung kommen auf, wenn man auf die Wohnungspolitik der letzten 35 Jahre blickt.
Im Jahr 1990 verwalteten die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften in Berlin fast 590.000 Wohnungen – 2010 waren es nur noch 270.000 Wohnungen.
Wo sind die restlichen 320.000 Wohnungen geblieben?
52.000 landeseigene Wohnungen wurden privatisiert wegen Rückübertragungsansprüchen (Restitution).
Auf Grundlage des Einigungsvertrags zum Anschluss der DDR an die Bundesrepublik Deutschland erfolgte die Rückabwicklung der in der DDR überwiegend staatlich und genossenschaftlich organisierten Wohnungsversorgung.
Die sogenannte Restitution sah nach 40 Jahren DDR die Rückgabe von Grundstücken an ihre Alteigentümer:innen beziehungsweise ihre Erb:innen vor. Die Entscheidung für die Rückübergabe von Privateigentum wurde mit moralischen und funktionalen Zielen begründet:
Zum einen wurde auf den Aspekt der „Wiedergutmachung“ früheren Unrechts verwiesen, zum anderen sollten durch Reprivatisierung der Wohngebäude Investitionen marktwirtschaftlich gesteuert werden und ebenso die weitere Verwertung dieser neuen Ware, genannt „Wohnung“.
Die kommunalen Wohnungsunternehmen in Ostberlin mussten auf diesem Weg 52.000 Wohnungen an private Eigentümer:innen zurückgegeben, die ihre oft sanierungsbedürftigen Häuser überwiegend schnell an professionelle Wohnungsunternehmen verkauften und in den Altbaugebieten regelrechte Verkaufswellen auslösten.
Zwingend war die Privatisierung dieser o.g. 50.000 Wohnungen aber nicht:
Immerhin wurden in der Ostberliner City im selben Zeitraum 50 Großprojekte deutscher und internationaler Investoren vom Koordinierungsausschuss Innenstadt (KOAI) auf den Weg gebracht, vorbei an den sonst üblichen Restitutionsverfahren und Planungsablaufen. Wo ein Wille, da auch immer ein Weg!(24)
46.000 landeseigene Wohnungen mussten wegen der Konstruktion der sogenannten Altschuldenhilferegelung privatisiert werden.
Nicht nur die vormals privaten Wohnungsbestände der DDR gerieten in den Privatisierungsstrudel. Durch die umstrittene Konstruktion sogenannter Altschulden , bei der die staatliche Finanzierung der DDR plötzlich in reale Schulden gegenüber privaten Banken verwandelt wurden, mussten auch die kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungsunternehmen mindestens 15% der Großwohnsiedlungen und sonstigen DDR-Bestände privatisieren.
Die Summe dieser „Altschulden“ betrug 26 Milliarden DM, die an die Bundesbank gezahlt werden mussten.
In Berlin betraf dies fast 50.000 Wohnungen, die vielfach an sogenannte Zwischenerwerber:innen verkauft wurden und heute teilweise von börsennotierten Wohnungsunternehmen verwaltet werden.
Mit dem Verkauf von 220.000 Wohnungen den Landeshaushalt finanziert
220.000 landeseigenen Wohnungen fielen im Zeitraum 1995 bis 2020 der sogenannten Vermögensaktivierungs-politik zum Opfer – die landeseigene Wohnungsgesellschaften verkaufen, die Erlöse flossen in den Landeshaushalt.
Durch die Privatisierung öffentlicher Grundstücke, Immobilien und Unternehmen sollten Deckungslücken im Haushalt geschlossen werden. Zur Sanierung der Finanzen wurden die landeseigenen Wohnungsgesellschaften auf zwei Arten kräftig gemolken:
122.000 Wohnungen mussten die landeseignen Wohnungsbaugesellschaften im Rahmen von Bestandsprivatisierung verkaufen – die Erlöse flossen in den Landeshaushalt
Diese Idee verdanken wir Finanzsenatorin Fugmann-Heesing (SPD), ab 1995, fortgeführt von Finanzsenator Sarazin (SPD) Motto: „Sparen bis es quietscht“:
Die 20 landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften mussten sich untereinander aufkaufen.
Übrig blieben schließlich sieben Gesellschaften.
Die Erlöse in Höhe von 600 Millionen DM flossen ans Land. Diese Summe plus Nebenkosten musste deshalb von der landeseigenen Wohnungsgesellschaft durch Kredite und Wohnungsverkäufe gegenfinanziert werden. Mit diesem Haushaltstrick entzogt das Land den Gesellschaften Eigenkapital in Milliardenhöhe.
Ein Großteil der Mieteinnahmen wurde Ende der 90er nur noch für Zinsen und Tilgung verwendet, was die Gesellschaften zwang, weitere Bestände zu verkaufen.
100.000 landeseigene Wohnungen gingen an Finanzkonsortien, die Erlöse flossen in den Landeshaushalt.
Im Jahr 2004 verkaufte das von einer rot-roten Koalition (Senat Wowereit II) regierte Land Berlin die landeseigene Wohnungsgesellschaft GSW mit einem Bestand von rund 67.000 Wohnungen zwei Milliarden Euro(25) an ein Konsortium bestehend aus den Investmentgesellschaften Whitehall Investments Ltd. und Tochtergesellschaften von Cerberus Capital Management.
Seitdem firmierte das Unternehmen als GSW Immobilien GmbH. Die GSW wird als Eigentümerin ihrer Immobilien weitergeführt, weil bei der Übertragung des Eigentums auf die Deutsche Wohnen AG Grunderwerbsteuer gezahlt werden müsste.
Sie ist aber nur noch eine formalrechtliche Hülle ohne eigene Rechtsbefugnis („Legaleinheit“). 2021 übernimmt Vonovia die Deutsche Wohnen.
2007 wurde die GEHAG GmbH mit 34.000 Wohnungen von der Deutsche Wohnen AG übernommen.
Das stärkt – so Deutsche Wohnen – ihre Kapazitäten und Ressourcen weiter und baut ihren Einfluss auf den Markt für sozialen und bezahlbaren Wohnraum aus.
Oder geht es auch nur um die Beschönigung eines Grunderwerbssteuer-sparenden Share Deals, wie bei der Übernahme der GSW?
Die Übernahme der Deutsche Wohnen AG durch Vonovia führte 2021 zur Schaffung eines der größten Wohnungsunternehmen Europas, von dem die GEHAG heute ein Teil ist.
Mittlerweise hat Berlin in den vergangenen 10 Jahren seinen Bestand an landeseigenen Wohnungen wieder auf rund 366.000 aufgestockt. Angesichts der Verheerungen, die sich seit Jahren auf dem Berliner Wohnungsmarkt zeigen, vereinbarten die aktuellen Regierungspartner CDU und SPD 2023 in ihrem Koalitionsvertrag sogar das Ziel, den kommunalen Wohnungsbestand schrittweise wieder auf eine halbe Million Wohnungen zu erhöhen (1) . Kann das gelingen? Und zu welchem Preis? Wie lief es bisher?
Rückkäufe ab 2019 auf Anweisung des Landes Berlin mussten selber finanziert werden
25.000 ehemalige landeseigene Wohnungen wurden seit 2019 von den landeseigenen Wohnungsunternehmen Degewo, HOWOGE, Berlinovo und Gewobag zurückgekauft. Auf Anweisung des Landes Berlin müssen sie die Ankäufe selber finanzieren. Eine Entscheidung zugunsten des Berliner Haushalts, aber zulasten der Mieter:innen.
6.000 Wohnungen: 2019 kaufte die landeseigene Wohnungsgesellschaft Gewobag von der Luxemburger Immobilienkonzern Ado Properties knapp 6.000 ehemaligen landeseigene Wohnungen sowie 70 Gewerbeeinheiten. Kosten 920 Millionen Euro, also 153.000 pro Wohnung.
Diese ehem. GSW-Wohnungen gingen 2004 für rd. 30.000 € an ein internationales Firmenkonsortium, siehe oben.
Für den Erwerb der zurückgekauften Wohnungen durch die Gewobag gibt es keine Zuschüsse des Landes.
14.750 Wohnungen: 2021 kauften die landeseigne Wohnungsgesellschaft HOWOGW, Degewo und Berlinivo von der Vonovia 14.750 ehemalige landeseigene Wohnungen zurück. Kaufpreis 2, 46 Milliarden Euro, also 167.000 Euro pro Wohnung.
Diese ehem. GSW-Wohnungen gingen 2004 für rd. 30.000 € an ein internationales Firmenkonsortium, siehe oben.
Für den Erwerb durch die durch die drei landeseigenen Gesellschaften gibt es keine Zuschüsse des Landes.: „Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD), der den Deal mit den Unternehmen ausgehandelt hat, wies die Kritik (an SPD-Hinterzimmer-Deal) zurück. Der Steuerzahler werde nicht belastet, da der Kauf von drei landeseigenen Wohnungsgesellschaften über Kredite finanziert werde. Der Sanierungsbedarf sei von den landeseigenen Gesellschaften zuvor gutachterlich überprüft worden. So werde die Berlinovo in den kommenden zehn Jahren 60 Millionen Euro in die Sanierung der Bestände investieren, die sie übernimmt“(2). 3.430 Wohnungen plus 91 Gewerbeeinheiten.Die Mieter:innen der zurückgekauften bestände dürfen sich auf steigende Mieten einstellen.
4.500 Wohnungen: 2024 kauft die landeseigne HOWOGE von der Vonovia 4.500 ehemalige landeseigene Wohnungen in Berlin Lichtenberg und Adlershof. Kaufpreis 700 Millionen, also pro Wohnung 155.000 €.
Diese ehem. GSW-Wohnungen gingen 2004 für rd. 30.000 € an ein internationales Firmenkonsortium, siehe oben.
Für den Erwerb der zurückgekauften Wohnungen durch die HOWOGE gibt es keine Zuschüsse des Landes.
Übrigens: Der Reingewinn, den die privaten Gesellschaften mit den Verkäufen erzielen, muss nicht versteuert werden, weil Spekulationsgewinne bei Immobilien nach 10 Jahre steuerfrei sind.(3)
Nach den Achterbahnfahrten: Landeseigene Wohnungsunternehmen haben fast 17 Milliarden Euro Schulden, Stand März 2023
Zwischen 1990 und 2010 mussten die landeseigenen Wohnungsgesellschaften auf Anweisung der jeweiligen Landesregierungen rd. 122.000 Wohnungen aus ihren Beständen verkaufen. Der Verkaufserlös musste an das Land Berlin abgeführt werden.
Wegen mangelnder Liquidität mussten die Kaufpreise wiederum von den landeseigenen Wohnungsgesellschaften überwiegend aus Krediten finanziert werden.
10 Jahre später werden die Wohnungsunternehmen erneut angewiesen, die ehemaligen Wohnungen der landeseigenen Gesellschaften zum fünffachen Wert zurückzukaufen. Da wundert es nicht, dass die landeseigenen Wohnungsgesellschaften hoch verschuldet sind (4).
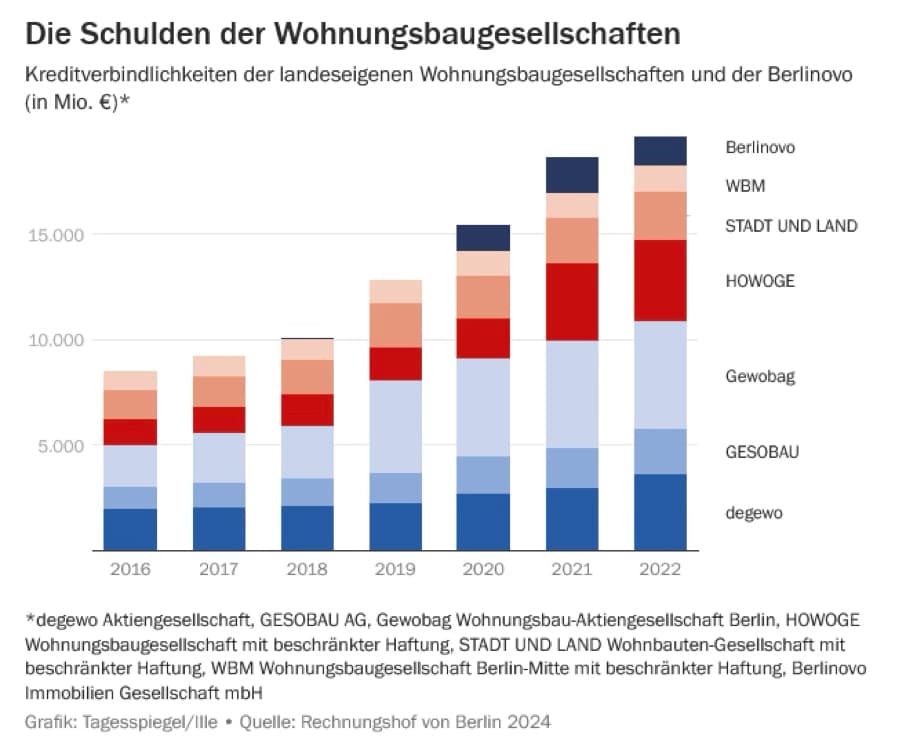
(28)
Die höchsten Schulden entfallen mit rund fünf Milliarden Euro auf die Gewobag, die mit Stand vom 31. Dezember 2021 über 73.398 eigene Wohnungen verfügt und damit das zweitgrößte landeseigene Wohnungsunternehmen ist.
Auf Platz zwei der Schulden-Rangliste steht mit Verbindlichkeiten von rund 3,6 Milliarden Euro die Howoge (65.131 Wohnungen), gefolgt von der größten landeseigenen Gesellschaft, der Degewo (73.915 Wohnungen), mit rund 2,9 Milliarden Euro Schulden, der Stadt und Land (50.527 Wohnungen) mit knapp 2,2 Milliarden Euro an Verbindlichkeiten, der Gesobau (45.090 Wohnungen) mit rund 1,9 Milliarden Euro Schulden und der WBM (31.590 Wohnungen) mit rund 1,2 Milliarden Euro Verbindlichkeiten.(5)
„Wenn man die Bilanzstruktur anschaut, haben die landeseigenen Wohnungsunternehmen relativ hohe Verschuldungsgrade, gemessen an der Eigenkapitalquote“, warnt Kholodilin, der am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung die Entwicklung des Wohnungssektors beobachtet. Vor allem die Gewobag mit ihren 58.000 Wohnungen nimmt der DIW-Wissenschaftler in den Blick. Sie weise lediglich eine Eigenkapitalquote von zehn Prozent auf, was bedeute, dass der Rest auf Fremdkapital basiere. „Das ist eine sehr hohe Verschuldung“, zeigt sich Kholodilin besorgt. SPD-Senator Gäbler räumt ein, dass die Gesellschaften einen Kapitalbedarf haben. ‚Deswegen brauchen wir weiter moderate Mietsteigerungen, die niemanden überfordern. Dafür haben wir das Leistbarkeitsversprechen, dass keine WBS-Empfänger mehr als 27 Prozent ihres Einkommens zahlen müssen und ansonsten gibt es auch individuelle Lösungen‘, sagt er. So haben sich Senat und landeseigene Wohnungsunternehmen in ihrer Kooperationsvereinbarung darauf verständigt, dass die Bestandsmieten bei den Unternehmen insgesamt nur um 2,9 Prozent im Jahr steigen dürfen. Der Berliner Mieterverein kritisiert dennoch, dass Mieterinnen und Mieter auf diese Art die Neubauten mitbezahlen müssen. Auch die Linke bezeichnet diese Quersubventionierung als falsch und die Regelungen zur Begrenzung der Mieterhöhungen als löchrig. Statt weiter an der Mietschraube zu drehen, brauche es eine andere Art der Finanzierung, fordert der mietenpolitische Sprecher der Fraktion im Abgeordnetenhaus, Niklas Schenker. „Das geht, wenn man dafür Kredite aufnimmt und die als Eigenkapitalzuführung an die landeseigenen Unternehmen gibt“, schlägt Schenker vor. Allerdings fehlen schon jetzt im Berliner Landeshaushalt Milliarden, die erst noch eingespart oder anderweitig ersetzt werden müssen. Zudem ist die Rechtmäßigkeit des von der schwarz-roten Koalition geplanten Sondervermögens fraglich“.(6)
Der Mieterverein warnt: Das soll nicht dazu führen, dass Berlin wieder landeseigene Wohnungen verkaufen.(31)
So gehen die Landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften mit ihren Mietern um
„Die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte hat Mieter unterschreiben lassen, dass sie Möglichkeiten zur Mietsenkung nicht in Anspruch nehmen“.(8)
„Die Hoffnung, dass durch den kommunalen Wohnungsmarkt der Anstieg der Mieten in Berlin gebremst wird, ist trügerisch. Das zeigt das Beispiel der WBM“.(9)
Von den Haushaltseinsparungen 2024/2025 bleiben auch die landeseigenen Wohnungsunternehmen nicht verschont: „Fast 200 Millionen Euro fallen bei der Wohnungsbauförderung weg und sollen stattdessen teilweise über die landeseigenen Wohnungsbauunternehmen kreditfinanziert werden.
Es ist abzusehen, dass die Abzahlung dieser Schulden auf die Mieterinnen und Mieter in Berlin umgelegt wird und auch die Mieten der landeseigenen Wohnungsbauunternehmen weiter steigen werden. Die Landeseigenen wollen bereits ab 2025 bei mehr als 90.000 Wohnungen die Miete zwischen durchschnittlich 7,9 und 9 Prozent erhöhen: nicht zuletzt auch, um Ihre Schulden für den Ankauf von Mietwohnungen der Deutsche Wohnen abzuzahlen, die der Berliner Senat zu überteuerten Marktpreisen anschaffte, anstatt den Volksentscheid zur Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen umzusetzen.
Auch die Neubaupläne der Landeseigenen dienten bisher als Begründung für die Notwendigkeit steigender Mieten. Diese »Notwendigkeit« dürfte sich damit verschärfen.“(10)
„Um Mehreinnahmen zu erzielen, wollen die Wohnungsbaugesellschaften des Landes zum Jahreswechsel für viele Haushalte die Mieten anheben“.(11)
Anstieg der Durchschnittsmieten in landeseigenen Wohnungen, Genossenschaften und frei finanzierten Wohnungen
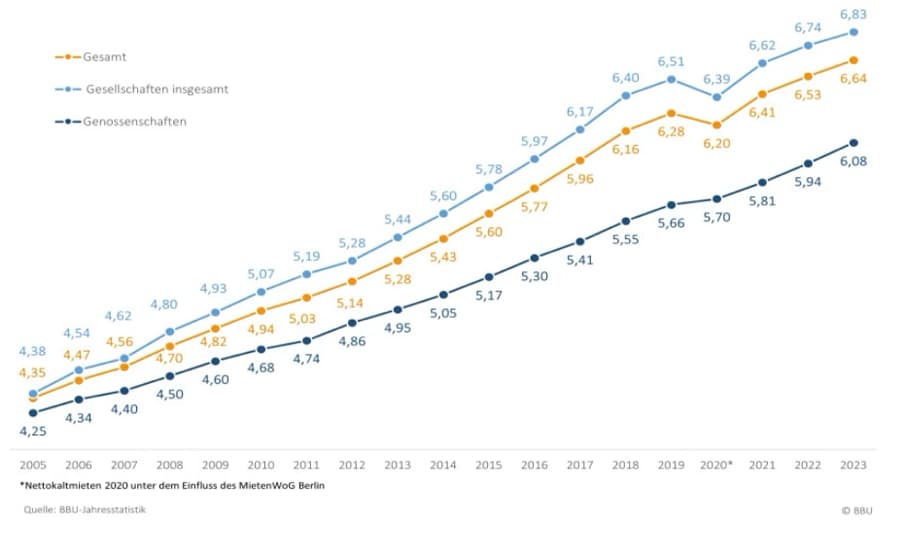
Stand 2024:
- Nettokaltmieten in Berlin Neubau 20,11 €
- Angebotsmieten 14,35 €
- Nettokaltmieten in Berlin 7,21 €
- Nettokaltmieten BBU 6,85 €
- Nettokaltmieten Genossenschaften 6,35 €(12)
(Ältere Daten (2019) geben für Genossenschaften Werte um 5,66 €/m² (13) an, was
den günstigeren Charakter verdeutlicht) - Nettokaltmieten Neuköllner Wohnungsgenossenschaft 5,52 €
(124 Jahre alt und deshalb schon seit langer Zeit entschuldet)
Landeseigene Wohnungen kommen und gehen – doch die Wohnungsnot bleibt bestehen – und ebenso, dass sich in Genossenschaften kaum jemand Sorgen um seine Wohnung machen muss!
Die beschriebenen Umstände führen letztlich dazu, dass es riskant erscheint, in Wohnungen zu wohnen, die dem Land Berlin gehören. Ebenso fatal ist es, in Sozialwohnungen zu wohnen und das Auslaufen der Sozial- und Mietbindung miterleben zu müssen.
Der Politik müssen die Wohnungen weggenommen werden. Die landeseigenen Wohnungen sollten mehrheitlich in genossenschaftliche Wohnungen umgewandelt werden.
Nur Genossenschaften verfolgen das übergeordnete Ziel, kostengünstige Wohnungen für ihre Mitglieder anzubieten. Als Kunde und Teilhaber der Genossenschaft erhält darüber hinaus jeder Mieter/Mieterin das Recht, auf die Entscheidungen der Wohnungsgenossenschaft einzuwirken!
Was das alles mit dem Großen Tiergarten zu tun hat, fragen Sie?
Wer 220.000 landeseigene Wohnungen mit rund 400.000 BewohnerInnen an die Börse verkauft, wer 21qkm landeseigene Grundstücke an Private verkauft, dem ist auch zuzutrauen, den Großen Tiergarten zur Sanierung des Berliner Landeshaushalts herzugeben. Zuzutrauen ist der Politik das allemal.
Fazit:
Um einem derartigen Irrweg gilt es, schon frühzeitig gegenzusteuern. Deshalb ist es im Sinne der Vorsorge erforderlich, schon hier und heute die notwendigen Entscheidungen zum dauerhaften und Erhalt des Großen Tiergartens im Eigentum des Landes Berlin zu treffen. Das Grünanlagengesetz muss per Volksbegehren ergänzt werden.
(1) Privatisierungspolitik in Berlin seit 1990, Andrej Holm, Arch+, Seite 102
(2) „Ausverkauf der Stadt: Die Hypothek der Linken“ von Yannic Walther, TAZ vom 25. 5. 2024, 07:00 Uhr
(3) „Diese Wohnungen kauft der Senat für 2,4 Milliarden Euro“, Berliner Morgenpost vom 17.09.2021
(4) „Berlin kauft 4.500 Wohnungen und Flächen von Vonovia“, rbb vom 24.04.24
(5) „Wegen der Haushaltskrise in Berlin: Wohnungsbaugesellschaften müssen immer mehr Aufgaben schultern. Der Landesrechnungshof ist alarmiert: Degewo und Co. häufen durch Immobilienankäufe immer höhere Schuldenberge an. Nun sollen ihnen auch noch Schulen, Rathäuser und Feuerwachen überschrieben werden.“ Von Reinhart Bünger 30.11.2024, 08:00 Uhr
(6) „Landeseigene Wohnungsunternehmen haben fast 17 Milliarden Euro Schulden. Die städtischen Vermieter sind hoch verschuldet. Der Mieterverein warnt: Das soll nicht dazu führen, dass Berlin wieder landeseigene Wohnungen verkaufen.“, von Ulrich Paul, Berliner Zeitung vom 03.03.2023
(7) „Hohe Schulden, hohe Ziele“ rbb24 von 6.4.2024Dorit Knieling und Jan Menzel
(8) „Landeseigene Wohnungsunternehmen haben fast 17 Milliarden Euro Schulden“, Berliner Zeitung, von Ulich Paul 10.8.2023
(9) „Landeseigene Wohnungsgesellschaft: WBM ließ Mieter auf Mietabsenkung verzichten“, von Theresa Roelke, Tagesspiegel, 30.12.2024
(10) „Wohnen in Berlin: Wie auch landeseigene Wohnbaugesellschaften Mietpreise nach oben treiben.“ von Jens Gerlach, Berliner Zeitung, 20.1.2025
(11) „CDU und SPD kürzen die Hauptstadt kaputt“, von Fabian Nehring, JACOBIN Magazin 28. November 2024
(12) „120.500 Berliner Haushalte betroffen: Landeseigene Wohnungsunternehmen drehen kräftig an der Preisschraube“ von Theresa Roelke, Tagessspiegel, 25.10.2024
(13) Alle Daten BBU Jahresstatistik und IBB-Wohnungsmarktbericht 2024
(14) https://www.genossenschafter-innen.de/2021/11/17/wohnungsgenossenschaften-in-berlin-ein-aktueller-ueberblick/?utm_source=chatgpt.com
4. Lösungsvorschläge: Zukunft der landeseigenen Wohnungsgesellschaften
LÖSUNGEN FÜR DIE MENSCHEN
Im Basistext wird ausführlich beschrieben, wie Berlin durch jahrzehntelange Privatisierung landeseigener Wohnungen in die aktuelle Wohnungsnot geraten ist – und welche Konsequenzen das hat. Daraus ergeben sich mehrere Vorschläge und Lösungsansätze für die Schaffung von preiswertem Wohnraum:
1. Stärkung des kommunalen Wohnungsbestands
Ziel der Berliner Landesregierung (CDU/SPD-Koalition 2023): den Bestand an landeseigenen Wohnungen wieder auf 500.000 zu erhöhen
Rückkäufe von ehemals privatisierten Beständen (z. B. 25.000 Wohnungen seit 2019 durch Degewo, Howoge, Gewobag usw.).
Kritik: Rückkäufe sind extrem teuer (2004 verkauft für ca. 30.000 €/Whg., jetzt Rückkauf für 150.000–170.000 €/Whg.) und verschulden die kommunalen Gesellschaften massiv.
2. Finanzierung und Verschuldung
Die landeseigenen Gesellschaften sind mit rund 17 Milliarden € verschuldet.
Forderung von Fachleuten: Statt Mieterhöhungen als „Quersubventionierung“ zu nutzen, solle das Land Berlin den Gesellschaften Eigenkapital zuführen, finanziert über öffentliche Kredite
3. Alternative Modelle: Wohnungsgenossenschaften
Der Text betont, dass Genossenschaften im Vergleich stabilere und günstigere Mieten bieten (z. B. 5,35–6,35 €/m²).
Vorschlag: Umwandlung landeseigener Wohnungen in Genossenschaftswohnungen, da diese langfristig am ehesten bezahlbare Mieten sichern und den Bewohner:innen Mitspracherechte geben
4. Kritik an aktuellen Maßnahmen
Rückkäufe ohne Zuschüsse vom Land → die Gesellschaften müssen Kredite aufnehmen, was wiederum Mieterhöhungen nach sich zieht.
Teilweise drohen ab 2025 Mieterhöhungen um 7,9–9 % für über 90.000 Wohnungen, um Schulden aus Rückkäufen zu tilgen
5. Langfristige Perspektive
Warnung vor einer Wiederholung der Fehler: Wohnungen dürfen nicht erneut verkauft oder „an die Börse gebracht“ werden.
Forderung: dauerhafte Sicherung öffentlicher bzw. genossenschaftlicher Bestände, um Spekulation und Privatisierung entgegenzuwirken.
Volksentscheid Deutsche Wohnen & Co. enteignen umsetzen!
Kurz gesagt:
Rückkäufe allein lösen das Problem nicht, da sie teuer sind und Schulden verursachen.
Stattdessen werden genossenschaftliche Strukturen als nachhaltige Lösung vorgeschlagen, da sie dauerhaft günstigen Wohnraum sichern.
Kommunale Bestände sollen wachsen, aber mit solider Finanzierung (öffentliche Kredite, nicht über Mieterhöhungen).
Lösungsvorschlag: Genossenschaftsmodell
Landeseigenen Wohnungen in eine Vielzahl von Genossenschaften umzuwandeln
Die Idee, die landeseigenen Wohnungen in Berlin in eine Vielzahl von Genossenschaften umzuwandeln, könnte als Gegenentwurf zu einer rein staatlichen Verwaltung durch die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften wie degewo, Gewobag, Howoge oder Stadt und Land verstanden werden.
Vorteile:
Ein solcher Schritt hätte mehrere potenzielle Vorteile. Er würde die Selbstverwaltung und Mitbestimmung der Mieterinnen und Mieter stärken, da diese in Genossenschaften zugleich Mitglieder sind und somit direkt über Themen wie Sanierungen, Mietgestaltung oder soziale Projekte im Haus beziehungsweise im Quartier mitbestimmen könnten. Dadurch ließen sich die Wohnungen stärker am tatsächlichen Bedarf der Bewohnerinnen und Bewohner ausrichten. Zudem wären langfristig bezahlbare Mieten besser zu sichern, da Genossenschaften nicht gewinnorientiert, sondern gemeinwohlorientiert arbeiten. Überschüsse würden nicht als Rendite ausgeschüttet, sondern in Instandhaltung oder Neubau investiert. Ein weiterer Vorteil bestünde in der Stärkung sozialer Bindungen, weil Genossenschaften häufig nachbarschaftliche Netzwerke, gemeinschaftliche Einrichtungen und kollektive Verantwortung für Gebäude und Umfeld fördern. Auch das Land Berlin selbst könnte entlastet werden, da es weniger Ressourcen in Verwaltung und Bewirtschaftung investieren müsste; Risiken und Verantwortlichkeiten lägen stärker bei den Genossenschaften.
Nachteile:
Demgegenüber gibt es jedoch auch erhebliche potenzielle Nachteile und Risiken. Eine Zersplitterung in viele kleine Genossenschaften könnte zu Koordinationsproblemen führen. Statt einer handlungsfähigen großen Akteurin gäbe es zahlreiche kleine Einheiten mit unterschiedlicher Verwaltung, Finanzkraft und politischer Schlagkraft. Die strategische Steuerung von Wohnungsbeständen – etwa für gezielte sozialpolitische Maßnahmen in bestimmten Vierteln – wäre deutlich schwieriger. Zudem besteht die Gefahr sozialer Selektivität: Manche Genossenschaften neigen dazu, sich eine „passende“ Mitgliedschaft zu schaffen, also eher einkommensstärkere oder besser organisierte Haushalte aufzunehmen. Dadurch könnten die einkommensschwächsten Mieterinnen und Mieter an den Rand gedrängt werden.
Auch die Finanzierung und Umsetzung großer Investitionen wäre problematisch. Während große landeseigene Gesellschaften leichter Zugang zu Krediten haben und Sanierungen oder Neubauten in größerem Maßstab finanzieren können, hätten kleinere Genossenschaften größere Schwierigkeiten, insbesondere bei energetischen Sanierungen oder Großprojekten. Hinzu kommen komplexe Rechts- und Eigentumsfragen: Eine Übertragung öffentlichen Eigentums an Genossenschaften wirft Fragen nach den Anfangsbedingungen, der Verteilung von Anteilen und der Vermeidung von Privatisierungen durch die Hintertür auf. Schließlich würde das Land mit der Aufgabe seiner großen Wohnungsbaugesellschaften ein wichtiges wohnungspolitisches Instrument verlieren, das bisher als Hebel gegen Mietsteigerungen auf dem Markt dient – etwa durch Mietpreisbegrenzungen im eigenen Bestand.
Zwischenmodelle
Denkbar wären allerdings auch Zwischenmodelle, die die Vorteile beider Ansätze verbinden. So ließe sich beispielsweise die Mitbestimmung der Mieterinnen und Mieter innerhalb der bestehenden landeseigenen Gesellschaften stärken, ohne den gesamten Bestand zu veräußern. Eine Möglichkeit bestünde in Teilübertragungen, bei denen nur bestimmte Quartiere oder Häuser in Genossenschaften überführt werden, um Modellprojekte zu schaffen. Alternativ könnten sogenannte Dachgenossenschaften gebildet werden, in denen kleinere Hausgenossenschaften koordiniert und gemeinsam finanziell abgesichert werden.
Insgesamt lässt sich festhalten, dass die vollständige Umwandlung der landeseigenen Wohnungen in viele kleine Genossenschaften zwar Partizipation und Nachbarschaft stärken würde, gleichzeitig aber erhebliche Risiken wie Zersplitterung, soziale Selektion und den Verlust politischer Steuerungsfähigkeit birgt. Wahrscheinlicher erscheint daher eine Weiterentwicklung des bestehenden Modells – etwa durch mehr Mitbestimmung innerhalb der landeseigenen Gesellschaften und gezielte Förderung neuer Genossenschaften – als praktikablere Lösung.
„Genossenschafts-Variante light“
Eine mögliche „Genossenschafts-Variante light“ könnte mehr Mitbestimmung ermöglichen, ohne den gesamten landeseigenen Bestand in Genossenschaften umzuwandeln. In dieser Variante blieben die großen landeseigenen Gesellschaften im Eigentum des Landes. Statt einer vollständigen Abgabe an Genossenschaften würden Teilbereiche, Häuser oder Quartiere in neue Organisationsformen überführt.
Zu den zentralen Elementen eines solchen Modells könnten Haus- oder Quartiersräte gehören. Jedes größere Wohnhaus oder Quartier bekäme einen gewählten Mieterinnen- und Mieterrat, der Mitentscheidungsrechte bei Sanierungsmaßnahmen, Modernisierungen (etwa energetischen Investitionen, dem Einbau von Balkonen oder Aufzügen), der Vergabe von Gewerbeflächen im Erdgeschoss sowie bei gemeinschaftlichen Projekten wie Grünflächen oder Spielplätzen hätte.
Darüber hinaus könnten Mieterinnen und Mieter freiwillig Anteile zu niedrigen Beträgen – beispielsweise zwischen 100 und 500 Euro – erwerben, um eine zusätzliche Bindung und einen genossenschaftsähnlichen Charakter zu schaffen, ohne dass das Land seine Eigentümerschaft aufgibt. Gewinne aus Nebennutzungen würden in Instandhaltung oder lokale Projekte zurückfließen. Für besonders engagierte Mietergruppen könnten zudem echte Genossenschaften entstehen, jedoch nur nach demokratischer Entscheidung der Bewohnerinnen und Bewohner. Das Land bliebe in diesem Fall Grundstückseigentümer und würde lediglich langfristige Erbbaurechte vergeben, um Privatisierung auszuschließen.
Eine übergeordnete Dachorganisation könnte schließlich die Mitbestimmung koordinieren, Erfahrungen bündeln, Standards sichern und Zersplitterung vermeiden – etwa durch Vorgaben zu Transparenz und sozialer Zugänglichkeit.
Vorteile:
Die Vorteile dieser „Light“-Variante liegen auf der Hand: Die Mitbestimmung der Mieterinnen und Mieter würde deutlich steigen, ohne dass das Land sein wohnungspolitisches Steuerungsinstrument verliert. Die soziale Durchmischung bliebe gewahrt, weil die großen Gesellschaften weiterhin Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten bereitstellen. Zudem könnten modellhafte Genossenschaften erprobt werden, ohne den gesamten Bestand umzustrukturieren. Das Land bliebe politisch flexibel und könnte weiterhin auf Entwicklungen des Wohnungsmarktes reagieren, etwa durch Mietpreisbegrenzungen oder Neubauquoten.
Insgesamt entstünde so ein Hybridmodell, bei dem die landeseigenen Gesellschaften das Rückgrat bilden, während Mieterinnen- und Mieterräte sowie Teilgenossenschaften mehr Demokratie und Nähe schaffen. Durch Erbbaurechte anstelle von Verkäufen bliebe zugleich der öffentliche Charakter des Wohnraums gewahrt.
5. Das System „Sozialwohnungen“
SOZIALER WOHNRAUM VERSCHWINDET
Das System „Sozialwohnungen“ – Anspruch und Realität in Berlin
„Niemand hat die Absicht, Geringverdienenden dauerhaft angemessenen und preiswerten Wohnraum zu verwehren.“ Doch wie wurde dieser Anspruch in der Berliner Politik umgesetzt?
1982 führte die CDU/CSU-FDP-Regierung ein System ein, das Investoren durch Abschreibungen in den sozialen Wohnungsbau lockte.
In Berlin entstanden zahlreiche Abschreibungsgesellschaften, deren Ziel es war, Verluste steuerlich geltend zu machen. Die Folge: Wohnungen wurden mit bis zu 23,50 DM/qm gebaut, jedoch nur durch Subventionen für 5,50 DM vermietet. Investoren profitierten steuerlich – der soziale Nutzen war begrenzt.
2003 beendete der SPD-PDS-Senat die Anschlussförderung. Eigentümer:innen durften nun teure Mieten verlangen. Zwar ging man davon aus, dass sie davon absehen würden, doch ab 2009 kam es zu massiven Mieterhöhungen und Verdrängungen.
2011 wurde ein Gesetz erlassen, das die vorzeitige Ablösung von Förderdarlehen ermöglichte – und damit den Rückzug der Sozialbindung beschleunigte.
2023 existieren nur noch etwa 100.000 Sozialwohnungen in Berlin, während fast eine Million Haushalte einen Wohnberechtigungsschein besitzen.
Bis 2025 fallen allein in Friedrichshain-Kreuzberg 2.500 weitere Wohnungen aus der Sozialbindung. Der Neubau kann diesen Verlust nicht ausgleichen, zumal Sozialbindungen zeitlich begrenzt sind.
Statt in den sozialen Wohnungsbau fließen jährlich rund 20 Mrd. € in Sozialausgaben zur Wohnunterstützung – und letztlich in die Taschen privater Investoren. Diese Politik stabilisiert die Wohnungsnot bewusst.
Ein Lichtblick sind Genossenschaften: Mit durchschnittlich 6,35 € Nettokaltmiete und lebenslangem Wohnrecht bieten sie tatsächlich sozialen Wohnraum. Doch sie werden beim Erwerb neuer Flächen zu wenig unterstützt.
Fazit:
Die offizielle Wohnungspolitik lässt sozialen Wohnraum verschwinden. Echte soziale Sicherheit bieten nur die Genossenschaften.
DAS VERSCHWINDEN DES SOZIALEN WOHNRAUMS HAT SYSTEM – NATÜRLICH HAT ABER NIEMAND DIE ABSICHT…
Aus der Vergangenheit für Gegenwart und Zukunft lernen
„Niemand hat die Absicht, Grünanlagen zu bebauen!“ Wirklich niemand und niemals? Zweifel an der Glaubwürdigkeit von Politik und Verwaltung kommen auf, wenn man auf das System Sozialwohnungen der letzten 35 Jahre blickt.
Berlin das Abschreibungs-Eldorado der 80er Jahre( 1)
1982 wurde von der CDU/CSU und FDP Koalition unter Helmut Kohl (CDU) ein Finanzierungssystem zur vorgeblichen Förderung des sozialen Wohnungsbaus angeboten. Die Berliner SPD/CDU West-Berlin machten daraufhin West-Berlin zum Abschreibungs-Eldorado für Geschäftemacher bei Abriss, Sanierung und Wohnungsneubau.
Das Finanzierungssystem sicherte Geldanlegern bei Abriss, Sanierung und Wohnungsneubau zusätzliche Profite. Zahlreiche Abschreibungskünstler organisierten in Berlin dieses Geschäft in Form von Abschreibungsgesellschaften.
Deren einziges Ziel war es, auf dem Papier, zumindest in den ersten Jahren, hohe Verluste zu erzeugen, um diese Verluste dann den Kapitalanlegern zuweisen zu können. Gleichzeitig sollten als Nebenprodukt Wohnungen abfallen, die jedoch von den Wohnungssuchenden nicht bezahlt werden konnten, weil zu teuer, nämlich rd. 23,50 DM/qm. Also subventionierte damals das Land Berlin jeden Quadratmeter sozialen Wohnraums mit rd. 18 DM. Nur deshalb konnte die Wohnung anschließend zur Sozialmiete von 5,50 DM auf dem Markt angeboten werden.
Das für den Kapitalanleger pleitesichere „Eigentum zum Null-Tarif-System“ war erfunden. Die Kapitalanleger sparten auf diese Weise kontinuierlich Steuern und wurden gleichzeitig mit jeder Verlustzuweisung immer mehr zu Hauseigentümern.
2003 beendete der SPD-PDS Senat die Anschlussförderung der Sozialwohnungen
Im Jahr 2003 beendete der SPD-PDS Senat die Anschlussförderung der Sozialwohnungen. Zuvor war es üblich, Sozialwohnungen nach einer 15-jährigen Grundförderung noch eine ebenso lange Anschlussförderung zu gewähren.
Als Beitrag zur Haushaltssanierung setzte der damalige Finanzsenator Thilo Sarrazin und sein Kollege Stadtentwicklungssenator Peter Strieder (beide SPD) hier den Rotstift an und nahm billigend in Kauf, dass dadurch die Sozialbindungen für rund 28.000 Wohnungen der Baujahre ab 1987 entfielen.
Die Eigentümer:innen, denen die Anschlussförderung verweigert wurde, durften die Miete auf die sogenannte Kostenmiete heraufsetzen – meist zwischen 12 und 16 Euro pro Quadratmeter. Solche Mieten am Markt durchzusetzen, erschien 2003 utopisch – weshalb man sich in der Politik darauf verließ, dass entsprechende Mieterhöhungen von den Eigentümer:innen auch nicht vorgenommen würden.
Drastischer Anstieg der Mieten in Sozialwohnungen durch vorzeitige Ablösung der Förderdarlehn
Doch 2009 gab es die ersten Fälle, in denen Sozialmieterinnen und -mieter mit astronomischen Mietforderungen vertrieben wurden. Die Wohnungen wurden dann – obwohl auf dem Papier immer noch Sozialwohnungen – profitabel neu vermietet oder verkauft.
Als Mittel gegen zu hohe Mieten im Sozialen Wohnungsbau erließ das Abgeordnetenhaus auf Vorschlag der Stadtentwicklungssenatorin Ingeborg Junge-Reyer (SPD) 2011 ein Gesetz, das den Eigentümer:innen eine vorzeitige Ablösung der Förderdarlehen ermöglichte und somit paradoxerweise das Verschwinden der Sozialbindungen noch zusätzlich beschleunigte.
Nur 10% der WBS-Berechtigten finden auch eine Sozialwohnung
Das Ergebnis dieser „Sozialpolitik“: „Jeder dritte Berliner Haushalt kann sich die Miete nicht leisten.“(2)
Gab es um die Jahrtausendwende in Berlin noch rund 430.000 Wohnungen, die zu staatlich festgelegten Mieten an Haushalte mit geringem Einkommen vermietet wurden, sank die Anzahl der Sozialwohnungen 2023 auf rd. 100.000 Wohnungen mit weiter sinkender Tendenz(3): Bis Ende 2025 werden im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ein Viertel aller Sozialwohnen , mehr als 2.500 WE, aus der Sozialbindung fallen.(4)
Das bedeutet in der Summe, dass von den rd. 970.000 Haushalten mit Wohnberechtigungsschein also fast 50% aller Berliner Haushalt, aktuell nur 10 % eine Sozialwohnung finden. Für die restlichen 90 % der betroffenen Haushalte gibt es kein sicheres Auffangnetz.
Der Verlust von Sozialwohnungen ist kein Fehler, sondern Absicht
Auch der aktuelle Neubau von Sozialwohnungen kann den Verlust nicht ansatzweise ausgleichen. Dabei wird erneut der uralte Fehler der Wohnungsbauförderung wiederholt: Die Sozialbindungen sind auf nur 30 Jahre begrenzt.
Dieses sich selbst verschlingendes System „Sozialwohnungen“ verhindert zu 100%, dass der Wohnungsmarkt im unteren und mittleren Bereich jemals ausgeglichen sein kann.
Das paradoxe System „Sozialwohnungen“ ist nicht ein „Fehler“, sondern Programm: Das paradoxe System hat sich sogar verfestigt: In den letzten Jahren gaben in Bund und Ländern weniger als 2,5 Mrd. € pro Jahr für den Sozialen Wohnungsbau aus, aber 20 Mrd. € Sozialausgaben für die Unterstützung von Menschen beim Wohnen, dass dann letztlich als zusätzlicher Profit wieder in die Kassen der Kapitalanleger fließt.(5)
Müsste es nicht genau umgekehrt sein? Der Staat baut Sozialwohnungen und gewährt Sozialausgaben beim Wohnen in Ausnahmefällen?
Die Folge dieser Politik des sich selbst verschlingenden Systems „Sozialwohnungen“ ist so offensichtlich, dass auch SPD und CDU um diese Entwicklungsperspektive wissen müssen und dennoch mit voller Absicht die Wohnungsnot im mittleren und unteren Wohnungsmarktsegment verstetigt. Somit ist das System „Sozialwohnungen“ nicht ein „Fehler“, wie der Berliner Mieterverein es nennt, sondern Programm: „Niedrige Mieten verhindern den Neubau“ wie es die Maren Kern, Mitglied des Vorstands des BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen ausdrückte. „Wir haben eine schwache Mietentwicklung bei hoher Kostenentwicklung“, sagt sie und folgert: „Wir haben eine Verlagerung von Neubau auf Sanierung im Bestand.“(48)
Dabei übersieht Maren Kern, dass die Wohnungsgenossenschaften, die dem BBU ebenfalls angehören, auch sogar mit netto Durchschnittsmieten von 5,10 € sehr wohl bauen können, weil von den Überschüssen der Genossenschaften nicht Segelyachten gekauft werden, sondern in die Bestände reinvestiert und auch neu vorbildlich gebaut wird.
Glücklich die BewohnerInnen von Genossenschaftswohnungen
Glücklich also jene Berliner:innen, die sich in Berlin in eine der über 190.000 Genossenschaftswohnungen retten können, dort preiswert wohnen und sogar mit lebenslangem Wohnrecht beschenkt werden.
Der Genossenschaftsanteil in den alten – und daher schuldenfreien Genossenschaft – beläuft sich auf ca. zwei Monatsmieten! Genossenschaftswohnungen sind am Ende des Tages die wirklichen Sozialwohnungen in Berlin.(7)
Es ist unbestritten, dass die Wohnungsgenossenschaften schon immer einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag mit ihren moderaten Mieten und stabilen Nachbarschaften leisten. Allerdings schafft es das Land Berlin nicht, die Genossenschaften ausreichend zu unterstützen. Speziell der Erwerb von landeseigenen Grundstücken gestaltet sich schwer, da dies zu überteuerten Preisen angeboten werden.
Für Genossenschaften ist es weiterhin sehr schwer, neue und auch bezahlbare Flächen für den zwingend benötigten Bau von Wohnungen zu erwerben. Der Bau von neuen Wohnungen durch Genossenschaften ist noch immer erforderlich, da die Genossenschaften nachweislich mit ihren sozialverträglichen Durchschnittsmiete von Netto kalt 5,81 €/2m (8) –zu einer Preisdämpfung auf dem Berliner Wohnungsmarkt beitragen.
Der Berliner Mieterverein fasst die Situation auf dem Wohnungsmarkt so zusammen: „Nach 70 Jahren (Berliner) Wohnungspolitik unter SPD und CDU sind die neuen Probleme auf dem Wohnungsmarkt die alten: „Die Versorgung breiter Bevölkerungsschichten mit bezahlbarem Wohnraum ist nicht nur gefährdet, sondern nicht mehr gewährleistet“.(9)
Das Pestel Institut aus Hannover bringt die Zusammenhänge so auf den Punkt: „Die Erstarrung der Wohnungsmärkte führt natürlich auch zur Erstarrung der Arbeitsmärkte, weil die Leute nicht mehr umziehen können, um Arbeitsplätze in anderen Regionen anzunehmen. Die Lösung der Wohnungsfrage ist Voraussetzung der wirtschaftlichen Entwicklung“, so Pestel-Chefökonom Günther.
Sozialwohnungen kommen und gehen – doch die Wohnungsnot bleibt bestehen – Dagegen bleibt in der Parallelwirtschaft der Genossenschaften das sorgenfreie Wohnen bestehen!
Entwicklung Nettokaltmieten Berlin 2005-2023
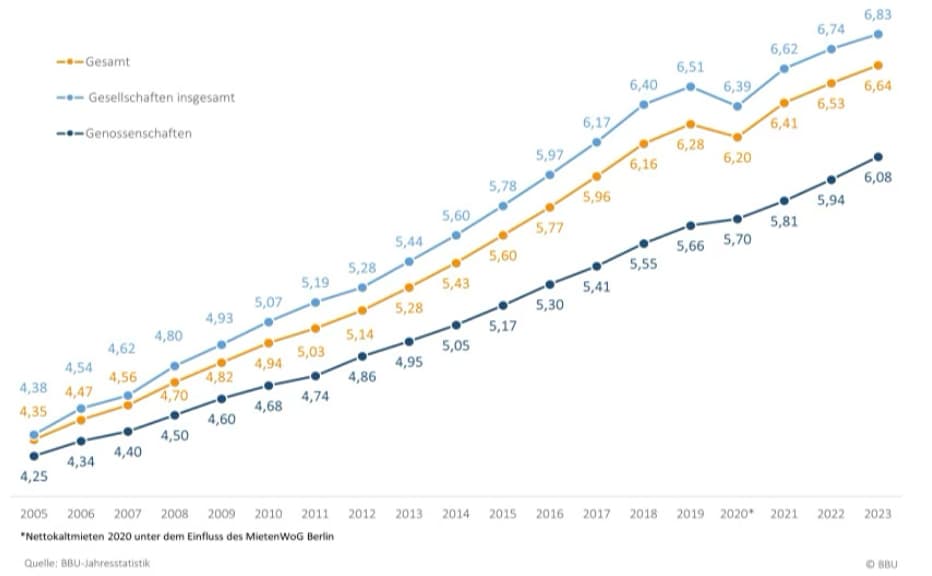
Stand 2024:
- Nettokaltmieten in Berlin Neubau 20,11 €
- Angebotsmieten 14,35 €
- Nettokaltmieten in Berlin 7,21 €
- Nettokaltmieten BBU 6,85 €
- Nettokaltmieten Genossenschaften 6,35 €(10)
(Ältere Daten (2019) geben für Genossenschaften Werte um 5,66 €/m² (11) an, was
den günstigeren Charakter verdeutlicht) - Nettokaltmieten einer Neuköllner Wohnungsgenossenschaft 5,10 €
Was das alles mit Grünanlagen zu tun hat, fragen Sie?
Wer ein System „Sozialwohnungen“ finanziert, dass nie der Lage sein kann, breite Bevölkerungsschichten nachhaltig mit Wohnraum zu versorgen, dem ist auch zuzutrauen, Grünanlagen zur Sanierung des Berliner Landeshaushalts herzugeben. Zuzutrauen ist der Politik das allemal.
Fazit:
Um einem derartigen Irrweg gilt es, schon frühzeitig gegenzusteuern. Deshalb ist es im Sinne der Vorsorge erforderlich, schon hier und heute die notwendigen Entscheidungen zum dauerhaften und Erhalt des Großen Tiergartens im Eigentum des Landes Berlin zu treffen. Das Grünanlagengesetz muss per Volksbegehren ergänzt werden.
7(1) mehr lernen: „Abschreibungs-Dschungelbuch“, 1982 Micha und Susanne Claassen mit Vorwort vom Berliner Mieterverein, 1982, oder „Berlinförderung und Sozialer Wohnungsbau in der „Inselstadt – Die besondere Situation West-Berlins und der politische Wille, die Stadthälfte als Schaufenster des Westens zu fördern, führten auch zu besonderen Förderprogrammen.“ von Johannes Ludwig, Bundeszentrale für politische Bildung, 2.10.2018
(2) „Neue Zahlen: Jeder dritte Berliner Haushalt kann sich die Miete nicht leisten“von Xenia Balzereit und Ida Luise Krenzlin, Berliner Zeitung vom 28.05.2024
(2) „Eine Kampagne, die keinen neuen Wohnraum schafft“, von isabell Jürgens, Berliner Morgenpost vom 27.06.2024, 16:00 Uhr
(4) Tagesschau.de/regional 26.7.2024
(5) „Sozialer Wohnungsbau in der Krise“, Berliner Mieterverein, MieterMagazin 3/24
(6) Glück, wer einen alten Mietvertrag hat in Berlin: Warum die Kluft zwischen Bestandsmieten und Angebotsmieten wächst“, von Reinhart Bünger, Tagesspiegel vom 26.07.2024, 15:19 Uhr
(7) Genossenschaften – Wohnungswirtschaft Deutschland
(8) Quelle: Seite 24 https://bbu.de/publikationen/bbu-jahresstatistik-2021
(9) Magazin / Online / MieterMagazin 3/24 / Sozialer Wohnungsbau in der Krise
(10) Alle Daten BBU Jahresstatistik und IBB-Wohnungsmarktbericht 2024
(11) https://www.genossenschafter-innen.de/2021/11/17/wohnungsgenossenschaften-in-berlin-ein-aktueller-ueberblick/?utm_source=chatgpt.com
6. bauen, bauen, bauen
ES BAUEN DIE FALSCHEN – FÜR PROFITE, NICHT FÜR MENSCHEN
Der Berliner Senat setzt weiterhin auf „bauen, bauen, bauen“ – doch gebaut wird am Bedarf vorbei.
„Niemand hat die Absicht, Geringverdiener aus Berlin zu vertreiben!“
Doch genau das passiert – jeden Tag. Wohnungsnot in Berlin – und keine Lösung in Sicht?
- 20,11 €/m² Kaltmiete im Neubau – wer soll das bezahlen?
- Neubauten stehen leer oder dienen als Renditeobjekte.
- Micro-Appartements fluten den Markt – unerschwinglich für Familien.
- Sozialwohnungen verschwinden: Seit 1990 sind 300.000 weggefallen.
Die Realität:
- Mehr Bauen nützt nur wenigen – den Investoren.
- Die Falschen bauen – für Profite, nicht für Menschen.
- Leerstand, Zweckentfremdung, überhöhte Mieten bleiben oft folgenlos.
- Die landeseigenen Wohnungsunternehmen sind überfordert und hochverschuldet.
- Vertrauen in die Politik? Fraglich – 220.000 Wohnungen hat Berlin schon einmal verscherbelt.
Die Alternative: Wohnungsgenossenschaften stärken
- Genossenschaften bauen nachhaltig, solidarisch und bezahlbar:
- Keine Spekulation – Wohnungen gehören der Gemeinschaft
- Demokratische Mitbestimmung statt Profitstreben
- Bauwerke nachnutzen und erhalten statt abreißen
- 100 Genossenschaften bieten bereits 200.000 Wohnungen in Berlin
Was wir fordern:
- Vergabe von Bauland auch – oder bevorzugt – an Genossenschaften
- Frühzeitige Einbindung der Genossenschaften bei Vorkaufsrechten in Milieuschutzgebieten
- Schluss mit dem Ausverkauf öffentlicher Grundstücke
- Konsequentes Vorgehen gegen Leerstand & Zweckentfremdung
- Umsetzung des Volksbegehrens „Deutsche Wohnen enteignen“
IN DER BERLINER WOHNUNGSBAUPOLITIK PASST REDEN UND HANDELN OFT NICHT ZUSAMMEN
Aus der Vergangenheit für Gegenwart und Zukunft lernen
Zweifel an der Glaubwürdigkeit von Politik und Verwaltung kommen auf, lässt man die Wohnungspolitik der Berliner SPD/CDU der letzten 35 Jahre Revue passieren.
20.000 neue Wohnungen pro Jahr hat Politik und Verwaltung 2023 als Ziel vorgegeben – und zweimal verpasst.(1) Die Lösung aus Sicht der Verantwortlichen: Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen, Bauland vergünstigt abgeben, Bürokratie und Bauvorschriften abbauen und so Anreize für Bauvorhaben schaffen.
Die Befürworter dieses Vorgehens werden dabei nicht müde den dadurch erzeugten „Sickereffekt im Wohnungsbau“ zu beschreiben.
Das soll ein Prozess sein, bei dem der Bau neuer Wohnungen, also teurer Neubau, indirekt zu einer Verbesserung der Wohnsituation für Haushalte mit geringerem Einkommen führen kann. Dies geschehe durch Umzugsketten, bei denen der Bezug neuer Wohnungen durch Besserverdienende dazu führe, dass deren bisherige Wohnungen für Haushalte mit niedrigerem Einkommen frei würden.
Eine schöne Theorie, wissenschaftlich nämlich nicht belegt, aber Entschuldigung für eine Vernachlässigung des sozialen Wohnungsbaus. Der Sickereffekt gilt übrigends auch als Argument, Reiche nicht extera zu besteuern . Und das geht so: Der Reichtum sickert irgendwann bis zum Ärmsten der Armen durch und dann haben wir endlich Wohlstand für Alle….
20,11 Euro pro Quadratmeter müssen Mieter zurzeit im Durchschnitt bezahlen, wenn sie in einen Berliner Neubau einziehen. Das entspricht 1.800 Euro kalt für eine 90-Quadratmeter-Wohnung.
Brisant, aber ein ernstzunehmendes Thema ist das Radikalisierungspotenzial in der räumlichen Abgeschiedenheit von kleinen Apartments: Menschen, die viel Zeit allein verbringen, können sich in digitalen Echokammern verlieren, weil es an sozialen Korrekturen oder Auseinandersetzung mit anderen Perspektiven im Alltag fehlt.
Auch wer sich unbeobachtet und ungebunden fühlt, kann sich in Meinungen verhärten, ohne Rückkopplung mit der Realität anderer. Das heißt selbstverständlich nicht, dass jeder Single automatisch gefährdet ist.
Aber: Soziale Kontrolle und Integration durch gemeinschaftliches Leben wirken eben oft deeskalierend. Und genau da, im Aushandeln von Regeln, liegen die Potenziale im Zusammenleben in Familien und Wohngemeinschaften. Toleranz üben, Kompromissfähig sein, Verantwortung für andere übernehmen und regeln im Dialog entwickeln und umsetzen.
Wer ständig nur allein lebt, trainiert diese Fähigkeiten nicht oder verlernt sie. Das kann sich langfristig auf die Fähigkeit zur demokratischen Teilhabe auswirken – denn Demokratie lebt von Kompromissen, Rücksichtnahme und Dialog.
Deshalb sollte es eigentlich ein gesamtgesellschaftliches Anliegen sein, gegen strukturelle Isolation, Vereinzelung, Mangel an sozialem Dialog und Verlust von kollektiven Erfahrungsräumen anzuarbeiten.
Deshalb sollte es eigentlich nicht nur die Aufgabe, sondern auch die Pflicht von Politik sein, durch Fördern und Fordern der Wohnungswirtschaft bezahlbare große Wohnungen für Familien und Wohngemeinschaften abzuverlangen.
Das sollte eigentlich auch und besonders für das Land Berlin als Vermieter gelten. Hier ist eine Übersicht zu den sechs landeseigenen Berliner Wohnungsbaugesellschaften (degewo, GESOBAU, Gewobag, HOWOGE, STADT UND LAND, WBM) mit einem Wohnungsbestand von 360.000 Wohneinheiten hinsichtlich des Bestandes nach Zimmeranzahl (Quelle: „Neue Regeln für Landeseigene: Wohnungsvergabe in Berlin soll sich stärker nach Haushaltsgröße richten.“, von Daniel Böldt, Christian Latz, Anna Thewalt, Tagesspiegel vom 15.9.2023.):
-
-
-
-
-
- Ein-Zimmer: 70.667 19,6%
- 1,5–2 Zimmer: 117.326 32,6%
- 2,5–3 Zimmer: 125.319 34,8%
- 3,5–4 Zimmer: 40.984 11,2%
- 5 Zimmer 5.180 1,4%
-
-
-
-
Nur 12,6% der landeseigenen Wohnungen sind für Familien mit mehr als zwei Kindern oder größeren Wohngemeinschaften geeignet.
„Beengt lebenden Familien wird das allerdings nicht helfen. Schließlich wächst in Berlin schon seit Jahren ein Neubau nach dem nächsten aus dem Boden. Zu oft stehen die entstandenen Wohnungen aber gar nicht für Berliner zur Verfügung, sondern dienen als Spekulationsobjekte. Etwa die vielen möblierten Micro-Appartements, die je nach Bezirk bis zu 70 Prozent der Immobilieninserate ausmachen und den Besitzern ordentlich Rendite bringen.
Große Neubauwohnungen dagegen stehen häufig leer. Entweder, weil sie ohnehin nur als Geldanlage gekauft wurden. Oder weil sie als absurd teure Mietwohnung auf dem Markt kommen, um den hohen Kaufpreis zu refinanzieren.
Wer 2023 in Berlin eine Wohnung im Neubau mietete zahlte im vergangenen Quartal rd. 20,11 Euro pro Quadratmeter – kalt. Kein Normalverdiener kann sich das leisten.“(2)
Konsequentes Durchgreifen bei Wohnungsmissständen
„Bauen, bauen, bauen“ scheint also keine Lösung für die Wohnungsnot zu sein, solange die Falschen bauen. Private Immobilienunternehmen wollen Gewinne erwirtschaften, was nur funktioniert, wenn Verkauf oder Vermietung das investierte Geld mit einem satten Plus wieder reinholen.
Hinzu kommt, dass Instrumente, die Mietsteigerungen verhindern sollen, nicht konsequent umgesetzt werden. Leerstand wird nicht ausreichend registriert und bekämpft. Eigentümer haben kaum Konsequenzen zu befürchten, wenn sie die Instandhaltung maroder Häuser verschleppen. Neubaumieten sind regelmäßig höher, als es die Mietpreisbremse erlaubt, ohne dass jemand einschreitet. Konsequentes durchgreifen bei solchen Missständen wäre eine Lösung!“(3)
Auf landeseigenen Wohnungsbau ist kein Verlass
Auf den landeseigenen Wohnungsbau zu setzen ist wohl eher keine nachhaltige Lösung. Zu ungewiss ist, ob die Landespolitik die verbliebenen Wohnungen eines Tages wieder als „Vermögensanlagen“ auf den Markt wirft, um Haushaltslöcher zu stopfen: Zwischen 1995 und 2010 verkaufte das Land Berlin unter ihren Bürgermeistern Diepgen (CDU) und Wowereit (SPD) auf Anraten ihrer Finanzsenatoren Fugmann-Heesing (SPD) bzw. Sarrazin (SPD) immerhin rund 220.000 kommunale Wohnungen zu Spottpreisen an Investoren.
Und das auch noch in Kombination mit dem Verkauf von 21 Quadratkilometern landeseigener Grundstücke (eine Fläche 14 mal so groß wie das Tempelhofer Feld!!).
Fehlentscheidungen wie diese haben das aktuelle Wohnungsproblem erst in Berlin verursacht.(4) Derzeit gehören nur noch 23 Prozent der ca. 1,4 Mio. Berliner Mietwohnungen den landeseigenen Wohnungsunternehmen.(5)
Im Jahr 1990, unter der Regierung von Helmut Kohl (CDU), wurde die Gemeinnützigkeit im Bereich des Wohnungsbaus in Deutschland aufgehoben.
Dies geschah durch das Steuerreformgesetz 1990, das das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG) mit Wirkung zum 1. Januar 1990 abschaffte.
Unter der rot-grünen Bundesregierung von Gerhard Schröder (1998–2005) wurde der deutsche Wohnungsmarkt zusätzlich für das globale Finanzkapital geöffnet. Motto: „Markt statt Staat“.
Ziel war, Städten und Gemeinden die Möglichkeit zu geben, jetzt ihre Wohnungsgesellschaften als „Vermögensanlagen“ zu betrachten und diese auf dem freien Markt zu verkaufen, um dann mit dem Erlös ihre Haushaltskassen zu sanieren. Absicherung gegen Wohnungslosigkeit und Dämpfung der Mietenentwicklung waren zuvor Sinn und Zweck landeseigener Wohnungsgesellschaften.
Jetzt waren sie nur noch finanzpolitischer Spielball von Geldanlegern.
Die Wohnungsnot wird seitdem noch verschärft durch das sich selbst verschlingende System der sogenannten „Sozialwohnungen“:
Seit 1990 fielen rd. 300.000 Sozialwohnungen aus der Preis- und Belegungsbindung. Verblieben sind Ende 2024 noch rd. 86.000 Sozialwohnungen mit weiter stark sinkender Tendenz.
Genossenschaftlichen Wohnungsbau fördern
Anders die Wohnungsgenossenschaften: Wohnungsgenossenschaften sind Unternehmen, die zum Ziel haben, ihre Mitglieder mit guten, bezahlbaren und sicheren Wohnungen zu versorgen. Im Vordergrund steht die Förderung der Mitglieder – nicht der Profit. Wohnungsgenossenschaften wirtschaften nachhaltig.
Überschüsse verbleiben in der Gemeinschaft und werden in den Besitz oder in Neubauten investiert.
Wohnen in einer Genossenschaft ist eine Art des eigentumsähnlichen Wohnens, eine Alternative zu Wohnen zur Miete oder Wohnen im Eigentum.
Wohnungsgenossenschaften sind Bestandshalter. Sie konnten ihre Bestände über zwei Weltkriege hinwegretten. Ihre Wohnungen werden i.d.R. nicht verkauft, sondern langfristig erhalten.
Dies ergibt sich aus der genossenschaftlichen Form, die wie keine andere den Bewohnern Beteiligungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten zusichert, alles geregelt im Genossenschaftsgesetz GenG.
In Berlin bieten ca. 100 Wohnungsgenossenschaften rd. 200.000 Wohnungen an.
Die Idee und Praxis von Genossenschaften wurden von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe der Menschheit anerkannt. Dies bedeutet, dass die Genossenschaftsidee, die auf Selbsthilfe, Selbstverantwortung und Solidarität basiert, eine kulturelle Tradition von globaler Bedeutung ist. Die Aufnahme in die Liste erfolgte am 30. November 2016 durch das zuständige UNESCO-Komitee.
Was also spricht dagegen, Wohnungsgenossenschaften zum zentralen Standbein der Berliner Wohnungspolitik zu machen? Widerstände aus der Politik von CDU und SPD und deren Lobbyisten! Sie wollen weiterhin die landeseigenen Wohnungen wie Vermögensanlagen behandeln, die man nach Kassenlage veräußern oder schröpfen kann.
Wenn CDU und SPD es ernst meinen würden mit ihrer Mieterschaft, würden sie Immobilien und Bauland vorrangig an Genossenschaften abgeben. Also z. B.: landeseigene Grundstücke zuerst Genossenschaften anbieten.(6) Im Falle von Vorkaufsrechten im Milieuschutzgebieten frühzeitig an die Berliner Genossenschaften herantreten und nicht erst dann, wenn die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften schon abgewunken haben.
Um auch hier voranzukommen, bedarf es vermutlich wieder eines Volksbegehrens.
Fazit:
Mit dem Motto der Baulobby: „Bauen, bauen, bauen“ könnte sogar der Große Tiergarten eines Tages unter die Räder einer kurzsichtigen Wohnungs- und Siedlungspolitik geraten. Deshalb ist es im Sinne der Vorsorge dringend erforderlich, schon hier und heute die notwendigen Entscheidungen zum dauerhaften Erhalt des Großen Tiergartens im Eigentum des Landes Berlin zu treffen. Das Grünanlagengesetz muss per Volksbegehren ergänzt werden.
P.S. Der ab Herbst 2025 neue § 246e BauGB(7) wird den Druck zum Umnutzen von Grünflächen noch erhöhen.
(1) „Wohnungsbau: Erneut weniger fertiggestellte Wohnungen in Berlin – Wohnungen sind in Berlin Mangelware. Doch beim Neubau geht es nur langsam voran, zuletzt sogar noch langsamer als zuvor“, dpa, Tagesspiegel vom 19.5.2025
(2) „Eltern, die auf Fluren schlafen: „Mehr bauen“ löst das Berliner Wohnproblem nicht“ von Anne Pannen, Tagesspiegel 25.2.2025
(3) ebenda
(4) Vergl. dazu auch „Berlins explodierende Bodenpreise machen Wohnungsbau unbezahlbar“, Recherche-Team zu ‚Ground-Control‘, veröffentlicht im Tagesspiegel, vom 2. 11. 2023
(5) „Landeseigene Wohnungsunternehmen haben fast 17 Milliarden Euro Schulden. Die städtischen Vermieter sind hoch verschuldet. Der Mieterverein warnt: Das soll nicht dazu führen, dass Berlin wieder landeseigene Wohnungen verkaufen.“, von Ulrich Paul, Berliner Zeitung vom 03.03.2023
(6) „Die Mittelschicht zieht weg aus Berlin“ Tagesspiegel von Theresa Roelke, 16.11.2024
(7) Der vom Bundeskabinett am 4. September 2024 beschlossene Entwurf § 246e hat folgenden Wortlaut:
„§ 246e Befristete Sonderregelung für den Wohnungsbau in Gebieten mit einem angespannten Wohnungsmarkt.
In einem Gebiet mit einem angespannten Wohnungsmarkt, das nach § 201a bestimmt ist, kann bis zum Ablauf des 31. Dezember 2027 mit Zustimmung der Gemeinde von den Vorschriften dieses Gesetzbuchs oder den aufgrund dieses Gesetzbuchs erlassenen Vorschriften in erforderlichem Umfang abgewichen werden, wenn die Abweichung unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist und einem der nachfolgend genannten Vorhaben dient:
1. der Errichtung eines Wohnzwecken dienenden Gebäudes mit mindestens sechs Wohnungen,
2. der Erweiterung, Änderung oder Erneuerung eines zulässigerweise errichteten, Wohnzwecken dienenden Gebäudes, wenn hierdurch neue Wohnungen geschaffen oder vorhandener Wohnraum wieder nutzbar werden, oder
3. der Nutzungsänderung einer zulässigerweise errichteten baulichen Anlage für Wohnzwecke, einschließlich einer erforderlichen Änderung oder Erneuerung.
Im Außenbereich findet Satz 1 nur auf Vorhaben Anwendung, die im räumlichen Zusammenhang mit Flächen stehen, die nach § 30 Absatz 1 oder § 34 zu beurteilen sind. § 18 Absatz 2 bis 4 des Bundesnaturschutzgesetzes ist anzuwenden. Bei Vorhaben nach den Nummern 18.7 und 18.8 der Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung bleibt die Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung oder einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls unberührt. Die Befristung nach Satz 1 bezieht sich nicht auf die Geltungsdauer einer Genehmigung, sondern auf den Zeitraum, bis zu dessen Ende im bauaufsichtlichen Verfahren von der Vorschrift Gebrauch gemacht werden kann. Für die Zustimmung der Gemeinde nach Satz 1 gilt § 36 Absatz 2 Satz 2 entsprechend.“
Einordnung: Der Ansatz, Wohnungsbau durch vereinfachte Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, ist nachvollziehbar – gerade in Ballungsräumen mit hohem Bedarf. Allerdings wird hier das Kind mit dem Bade ausgeschüttet: An die Stelle eines demokratischen Planungsverfahrens nach § 30 BauGB tritt, das verwaltungsinterne Baugenehmigungsverfahren. Durch die unselige Kombination aus geringer Öffentlichkeit, Entscheidungszentrierung und wirtschaftlichem Interesse wird das Verfahren anfällig für Korruption. Der neue § 246 e unterläuft aber auch Bemühungen zur flächensparenden Stadtentwicklung. – der Druck auf die ohnehin knappen urbanen Grünflächen und ökologisch wertvolle Gebiete wird erhöht. Der wohnungspolitische Nutzen steht dabei in keinem angemessenen Verhältnis zum Flächenverbrauch. Effektiver wären flächensparende Maßnahmen wie die Nutzung von Baulücken und minder genutzten Baugrundstücken sowie eine gezielte Entwicklung des bisher eher vernachlässigten ländlichen Raums. Dazu bedürfte es allerdings entsprechender steuerlichen Regelungen/Anreize.
Dem Gesetzentwurf § 246e BauGB soll im Herbst 2025 von der CDU-SPD Koalition zugestimmt werden. Kein guter Tag für den Tiergarten und alle anderen urbanen Grünflächen.
7. Immer weniger Baugenehmigungen in Berlin:
Warum auf absehbare Zeit kaum neue Wohnungen entstehen werden
HÜRDEN, UNEINIGKEIT, FEHLENDER WILLE BLOCKIEREN BAUGENEHMIGUNGEN
In Berlin verschärft sich die Wohnungsnot, weil die Zahl der Baugenehmigungen und festgesetzten Bebauungspläne (B-Pläne) dramatisch sinkt.
Trotz steigender Bevölkerung und Zuzugs von Kriegsflüchtlingen blockieren administrative Hürden, politische Uneinigkeit und fehlender Wille in Bezirken und Senat den dringend benötigten Wohnungsbau.
Wichtige Fakten und Entwicklungen
1. Rückgang der Baugenehmigungen
- Berlin: Im 1. Quartal 2024 wurden 3.659 Wohnungen genehmigt – 42,1 % weniger als im Vorjahreszeitraum.
- Ein- und Zweifamilienhäuser: 208 Wohnungen (−18,1 %)
- Mehrfamilienhäuser: 3.151 Wohnungen (−38,1 %)
- Bundesweit: Seit April 2022 sank die Zahl der Baugenehmigungen um 43,5 %.
- Fertigstellungen 2023: Nur 14.633 Wohnungen in Berlin (−5 % zum Vorjahr).
2. Bebauungspläne: Flaschenhals des Wohnungsbaus
- 2023 setzte Berlin nur 15 neue B-Pläne fest – ein Tiefstand seit 2002.
- Durchschnitt: 1 B-Plan pro Monat (unter Senator Christian Gaebler, SPD).
- Folgen: Ohne B-Pläne keine Baugenehmigungen – und damit kein Neubau.
3. Gründe für die Krise
- Politische Blockaden: Bezirke und Senat handeln zögerlich, um Wählerproteste zu vermeiden.
- Verwaltungsstrukturen: Komplexe Zuständigkeiten zwischen Land und Bezirken, Personalmangel und lange
- Bearbeitungszeiten (z. B. 126 Monate in Steglitz-Zehlendorf).
- Finanzielle Anreize fehlen: Bezirke tragen Kosten für Infrastruktur (Kitas, Schulen), profitieren aber nicht von Steuereinnahmen.
- Hohe Standards und Kosten: Überambitionierte Energieeffizienz-Vorgaben (z. B. EH 40-Standard) und gestiegene Baukosten bremsen Projekte aus.
- Ideologische Hürden: Forderungen nach sozialer Infrastruktur (Kitas, Spielplätze) verzögern Pläne.
4. Wirtschaftliche und soziale Folgen
- Mietpreise steigen durch Wohnraumknappheit.
- Bauwirtschaft leidet: Insolvenzen und Arbeitsplatzverluste im Sektor.
- Prognosen: Bis 2045 wird Berlins Bevölkerung auf 4,36–4,5 Millionen wachsen – der Bedarf an Wohnungen bleibt gedeckt.
5. Stimmen aus der Praxis
- Bernhard Haaß (IHK): „Die Bezirke mauern, der Senat hat keinen politischen Willen.“
- Bauverbände (GdW, ZDB): Fordern Vereinfachung von Vorschriften, digitale Verwaltung und langfristige Förderprogramme.
- Projektentwickler: Klagen über „alteingesessene“ Mitarbeiter in Ämtern, die Veränderungen blockieren.
6. Lösungsvorschläge
- Beschleunigung von Planungsverfahren (z. B. durch Digitalisierung).
- Lockerung von Bauvorschriften und Vereinheitlichung der Standards.
- Mehr bezahlbares Bauland, auch für Genossenschaften.
- Grafiken im Artikel
- Festgesetzte Bebauungspläne (1998–2023):
Spitzenjahr 2016, seitdem stark rückläufig. - Genehmigte Wohnungen (2023 vs. 2024):
2024 deutlich weniger Genehmigungen als 2023.
Fazit:
Berlin steckt in einer selbstgemachten Wohnungsbaukrise. Trotz bekannter Probleme (Bevölkerungswachstum, Bürokratie, Kosten) fehlen wirksame Maßnahmen. Die Folgen: weniger Neubauten, steigende Mieten und wirtschaftliche Einbußen.
DAS WOHNUNGSNEUBAUVOLUMEN WIRD WEITER SINKEN – AUS DEM TAGESSPIEGEL
„Aus der Katastrophe mit Ansage ist ein Klagelied in Dauerschleife geworden, dem offenbar niemand zuhört.“ — Dirk Salewski, BFW-Präsident
Im Folgenden ein erhellender Tagesspiegelartikel, Stand: 29.06.2024, , von Reinhart Bünger
Immer weniger Baugenehmigungen in Berlin: Warum auf absehbare Zeit kaum neue Wohnungen entstehen werden
Um Berlins Wohnraummangel zu heilen, bräuchte es Bauaufträge. Doch es gibt immer weniger Bebauungspläne. Und Ämter verfolgen teils andere Interessen. Eine Analyse.
Die Zahl der Baugenehmigungen in Deutschland geht seit mittlerweile zwei Jahren Monat für Monat zurück. Doch in Berlin war der Rückgang im ersten Quartal besonders besorgniserregend, angesichts des gleichzeitigen Zuzugs von Kriegsflüchtlingen und der Bevölkerungsprognose.
Bei einer bisher angenommenen Einwohnerzahl von 3,87 Millionen würde Berlin im Jahr 2045 nach einer aktuellen Erhebung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) etwa 4,36 Millionen Einwohner haben. Nach einer aktuellen Untersuchung von Deutsche Bank Research werden in Berlin bereits 2040 rund 4,5 Millionen wohnen.
Auch die diese Woche nach unten korrigierte Bevölkerungsschätzung, wonach zum Zeitpunkt des Zensus 2022 „nur“ 3,6 Millionen Menschen in Berlin lebten, dürfte allenfalls im Detail daran etwas ändern, aber nicht am Trend.
In der Hauptstadt bleibt eine starke Zunahme der Bebauungsplanverfahren zu erwarten. Denn Bebauungspläne („B-Pläne“) sind die Grundlage für Baugenehmigungen, sind das A und O, wenn um die Devise „Bauen, Bauen, Bauen“ geht. „Doch die Bezirke mauern und der Senat hat nicht den politischen Willen, wirklich Wohnungsbau gegen ablehnende Wähler durchzusetzen“, sagt Rechtsanwalt Bernhard Haaß, Koryphäe in Sachen Berliner Bauleitplanung und Leiter eines entsprechenden Arbeitskreises bei der Industrie- und Handelskammer (IHK). „2023 haben die zwölf Bezirke und die Senatsstadtentwicklungsverwaltung zusammen ganze 15 Bebauungspläne festgesetzt.“
Mauern statt Bauen ist die Devise
Aus der Ankündigung des damaligen Stadtentwicklungssenators Andreas Geisel (SPD), der Berlin nach der ersten Flüchtlingskrise 2015 eine neue Gründerzeit versprach, seine Verwaltung 2016 gar zur „B-Plan-Fabrik“ für Modulbauten machen wollte, wurde nichts. So setzt sich die Abwärtsspirale weiter fort.
Dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg wurden von Januar bis April 2024 in Berlin 3659 genehmigte Wohnungen gemeldet. Das sind 42,1 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Den amtlichen Zahlen zufolge sind in Ein- und Zweifamilienhäusern 208 Wohnungen geplant (minus 18,1 Prozent), in Mehrfamilienhäusern 3151 (minus 38,1 Prozent).
Durch geplante Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden, zum Beispiel Nutzungsänderungen und Dachgeschossausbauten, werden weitere 253 Wohnungen (Vorjahr: 568) zur Verfügung stehen.
Die Bezirke mauern und der Senat hat nicht den politischen Willen, wirklich Wohnungsbau gegen ablehnende Wähler durchzusetzen.
Bernhard Haaß, Leiter des Arbeitskreises Bauleitplanung bei der Industrie- und Handelskammer zu Berlin (IHK)
Das bundesweite Planungsgeschehen stimmt ebenso wenig optimistisch. Auch hier gehen die Zahlen zweistellig zurück. In den ersten vier Monaten dieses Jahres wurden 71.100 Wohnungen genehmigt – 18.900 oder 21 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistikamt mitteilte. „Seit April 2022 ist die Zahl der Baugenehmigungen um 43,5 Prozent zurückgegangen“, ergänzte dazu Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW.
Wird nicht genehmigt, wird nicht gebaut
Der BFW Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen forderte angesichts der aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes die Bundesregierung auf, endlich der brisanten Lage entsprechend zu handeln: Teure Anforderungen sollten heruntergesetzt werden. „Denn es kommen keine Projekte nach – die Auftragspipeline ist leergelaufen“, sagte BFW-Präsident Dirk Salewski in Berlin; „Aus der Katastrophe mit Ansage ist ein Klagelied in Dauerschleife geworden, dem offenbar niemand zuhört. Seit bereits 24 Monaten blicken wir auf die abnehmende Zahl von Baugenehmigungen. Bundesbauministerin Geywitz hält die Lage für stabil – das Einzige, was stabil ist, ist der Niedergang.“
„Was heute nicht genehmigt wird, können wir morgen nicht bauen und wird den Mieterinnen und Mietern am Markt fehlen“, warnte der Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB). Schon jetzt müssten hunderttausende Wohnungen zusätzlich beauftragt werden. „Davon sind wir meilenweit entfernt.“ Der GdW unterstützt diese Einschätzung. „Die fehlenden Baugenehmigungen von heute sind die einbrechenden Fertigstellungszahlen von morgen“, sagte Spitzenfunktionär Gedaschko.
Würde es eine eindeutige und langfristige Fördersystematik geben, die den EH 55-Standard einschließt, und nicht nur den überambitionierten EH 40-Standard, würde das dem Wohnungsbau einen merklichen Schub geben, sagte Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe: „Wer auf ein Ende der Wohnungsbaukrise hoffte, wird weiter enttäuscht. Im April verzeichnen wir gegenüber dem schlechten Vorjahresmonat einen weiteren Rückgang der Baugenehmigungen um dramatische 17 Prozent. Seit Jahresbeginn wurden lediglich 17.600 Wohnungen genehmigt, während es vor zwei Jahren noch 31.150 waren. Es ist ein regelrechter Absturz, ein Ende dieser Abwärtsspirale nicht absehbar.“
Komplett gegen den erforderlichen Trend in Berlin gerichtet, sank die Zahl der festgesetzten Bebauungspläne 2023. Nach Zahlen des privaten Immobiliendatenanalyseinstituts Bulwiengesa, der die Daten der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen zugrunde liegen, wurde mit 13 festgesetzten B-Plänen durch das Land Berlin im vergangenen Jahr ein neuer Tiefpunkt seit 2002 erreicht. Nach Angaben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen bleibt es dabei: nach 14 Monaten der Amtszeit von Senator Christian Gaebler (SPD) sind es insgesamt 14 B-Pläne, also weiterhin 1,0 pro Monat im Durchschnitt (Stand: 21. Juni).
Nicht nur den Verwaltungsrechtler Bernhard Haaß ärgert das seit Jahren. „Über Baulückenfüllung hinaus bedarf nennenswerter Wohnungsbau Bebauungsplänen“, sagt er dem Tagesspiegel. Dafür sind seit der Verfassungsreform von 1998 die Bezirke zuständig. „Die haben von mehr Bewohnern aber nur mehr Kosten durch Kindergarten- und Schulplätze, Sozialbetreuung, Verwaltungsaufwand undsoweiter, aber keine zusätzlichen Einnahmen“, gibt der Jurist zu bedenken.
„Im Gegensatz zu jeder Gemeinde bekommen sie keinen Anteil an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer. Das verteilt der Finanzsenator. Die Bezirke haben mehr Macht, aber keine steuerliche Verantwortung.“
Fertigstellungen in Berlin und im Bund
Im Jahr 2023 wurden laut Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 14.633 Wohnungen in Berlin fertiggestellt, ein Rückgang von fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
Mit Blick auf die gesamte Bundesrepublik wurden im vergangenen Jahr laut Statistik 294.400 Wohnungen fertiggestellt. In diesem Jahr geht die Baubranche von nur rund 235.000 fertiggestellten Wohnungen aus. Der Bedarf liegt laut Schätzung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) wegen der deutlich gestiegenen Zuwanderung aber bei jährlich 372.000 Wohnungen bis 2025.
Die Bevölkerungsprognose des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) lässt nun eine weitere Verschärfung des Wohnraummangels erwarten. Für Berlin und Umland rechnet das BBSR bis 2045 mit einem Anstieg um mehr als zwölf Prozent. Bereits seit 2011 verzeichnet Berlin in absoluten Zahlen das jährlich größte Bevölkerungswachstum unter den Städten im deutschsprachigen Raum. Grund für die Bevölkerungsentwicklung, die durch Zuwanderung und Überalterung geprägt ist, war zuletzt vor allem der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine.
„Durch die nach wie vor hohe Wohnungsknappheit bei gleichzeitig kommendem Einbruch der Neubautätigkeit steigen die Mieten derzeit außerordentlich schnell“, analysiert Reiner Braun, Vorstandsvorsitzender der Empirica ag und Geschäftsführer der Empirica Regio GmbH. An dieser Situation wird auch das sogenannte Schneller-Bauen-Gesetz wenig ändern, da es erst in Jahren greift.
Aufstellungsbeschlüsse rückläufig
Die Anzahl von Aufstellungsbeschlüssen ist weiter rückläufig, sodass das Wohnungsneubauvolumen weiter sinken wird. Damit korrespondieren der Zins- und Inflationsanstieg sowie die gestiegenen Baukosten: Alle Faktoren führen zu einem Rückgang der Bautätigkeit.
Die Folgen sind der Verlust von Fachkräften, Arbeitsplätzen und immer mehr fehlende Wohnungen. Neben der Unterversorgung mit Wohnraum gehören zu den wirtschaftlichen Folgen: Insolvenzen und Arbeitsplatzabbau im Baugewerbe.
„Der alarmierende Absturz beim Wohnungsneubau geht wie befürchtet weiter und gewinnt dabei sogar noch an Geschwindigkeit“, sagte Gedaschko bereits angesichts der im März veröffentlichten Baugenehmigungszahlen. „Obwohl Idee und Lösungen auf dem Tisch liegen, bleiben eine Reaktion und wirksame Maßnahmen der Regierung gegen die Wohnungsbaukrise quasi aus.“
„Oft scheitert es an alteingesessenen Mitarbeitern im Stadtplanungsamt und in der Bauaufsicht.“
Anonymer Projektentwickler, dessen Unternehmen um die Bezirke Pankow und Charlottenburg-Wilmersdorf einen weiten Bogen macht.
„Die Neubautätigkeit muss dringend wieder angekurbelt werden“, sagt auch Sascha Klaus, Vorstandsvorsitzender der Berlin Hyp. „Eine Vereinheitlichung der Bauverordnungen sowie Lockerungen der Bauvorschriften und digitale Schnittstellen würden dazu beitragen, dass der Wohnungsbau wieder deutlich an Fahrt aufnehmen kann.“
Ämter und Bezirksbürgermeister oft uneins
Neben den Baukosten spielt die Komplexität Berliner Verwaltungsstrukturen durch die Zweistufigkeit (Land/Bezirke) eine große Rolle: Ein Gegeneinander der Ämter und der politischen Führung ist in den Bezirken zwar nicht die Regel, kommt aber häufig vor. Personalmangel führt überdies zu Wartezeiten bei Projektentwicklern, die Bauvorhaben entwickeln wollen.
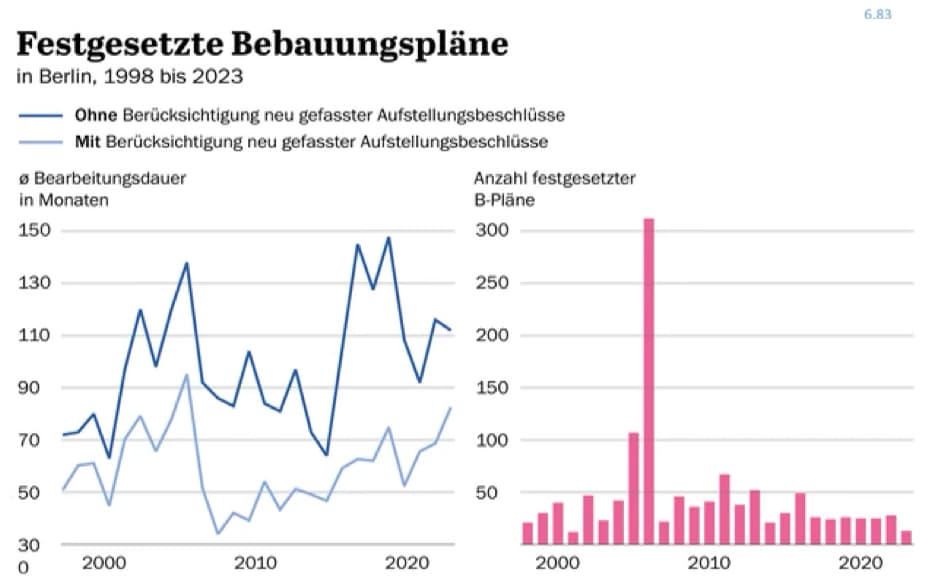
© Grafik: Tagesspiegel/Ille |Quelle: bulwiengesa basierend auf Daten der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, Stand: 17.01.2024
In dieser Gemengelage wurden in den Bezirken Mitte (187), Spandau (154) und Treptow-Köpenick (127) seit 1998 die meisten Bebauungspläne aufgestellt. In Pankow (58), Steglitz-Zehlendorf (67) und Friedrichshain-Kreuzberg (72) die wenigsten. Dies geht aus einer Studie über die „Dauer der Bebauungsplan-Verfahren in Berlin (2024)“ von Bulwiengesa hervor und hat durchaus System.
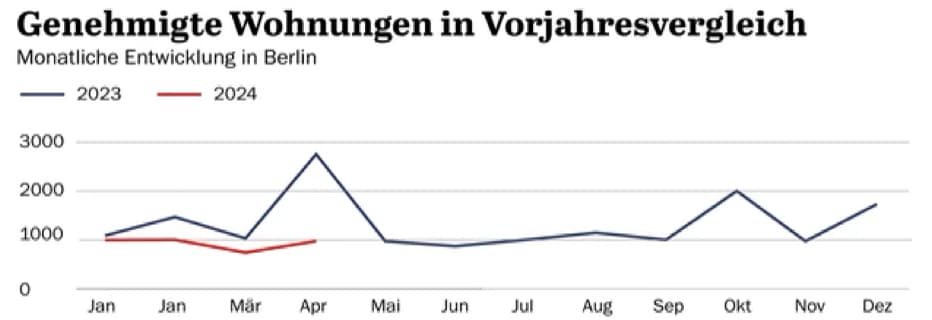
© Grafik: Tagesspiegel/Ille | Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
„Egal, ob der politische Wille da ist, oft scheitert es an alteingesessenen Mitarbeitern im Stadtplanungsamt und in der Bauaufsicht“, sagt ein Insider aus der Riege der Projektentwickler.
Lange Planungszeitläufte in Steglitz-Zehlendorf
Um den Bezirk Pankow machen viele Investoren inzwischen einen weiten Bogen. Auch in Charlottenburg-Wilmersdorf nehmen Projekte einen zähen Verlauf, trotz eines engagierten Baustadtrates. In Steglitz-Zehlendorf gehört zu den Bezirken, wo Planverfahren besonders lange dauern, im Durchschnitt 126 Monate.
Diese Zahl und andere Berechnungen zum Verlauf von B-Plänen, aufbereitet vom Landesverband BFW Bundesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen e.V., bedürfen indes der Einordnung.
Was ist ein Bebauungsplan?
Bebauungspläne werden von den Gemeinden, in Berlin vor allem von den Bezirken angefertigt, um die städtebauliche Entwicklung im zu bebauenden Gebiet zu steuern. Sie werden auf der Grund des jeweiligen Flächennutzungsplanes entwickelt. Dieser wird auch als vorbereitender Bebauungsplan bezeichnet. Er enthält Angaben darüber, welche Nutzungsart wo im Gebiet möglich ist. Sie regeln auch, ob ein Grundstück zu Gewerbezwecken oder als Wohnfläche, Fußweg, Straße, Grünanlage oder zum Beispiel als Kinderspielplatz genutzt werden darf.
„Der Bebauungsplan enthält genaue Vorgaben zu den Gebäuden, die auf einem Grundstück errichtet werden dürfen. Dazu zählt auch, wie viele Geschosse zulässig sind. So wird beispielsweise verhindert, dass mehrstöckige Häuser das angrenzende Bauland verschatten“, sagt Matthias Klauser, der von 2015 bis 2022, zuletzt als Chief Revenue Officer bei McMakler tätig war. Die Einsichtnahme in den Bebauungsplan (B-Plan) ist für jedermann möglich. Den B-Plan können Kaufinteressenten beim zuständigen Bauordnungs- oder Stadtplanungsamt anfordern und einsehen.
Ein Beispiel aus Neukölln, auf das Bezirksstadtrat Jochen Biedermann hinweist: Es sei gängige Praxis, Aufstellungsbeschlüsse für Bebauungspläne zu fassen, um einen bezirklichen Planungswillen zu dokumentieren, schreibt er.
„Das führt naturgemäß zuweilen zu einer langen ‚Bearbeitungszeit‘, in Neukölln beispielsweise beim B-Plan XIV-60, dessen prioritäre Bearbeitung erst aufgrund einer Veränderungssperre letztlich zur Festsetzung führte“, schreibt Baustadtrat Biedermann dem Tagesspiegel. „Der Aufstellungsbeschluss erfolgte im Dezember 1963, die Festsetzung im April 2019. Damit war der B-Plan zwar rechnerisch insgesamt 664 Monate im Verfahren, wurde während der meisten Zeit davon aber gar nicht aktiv bearbeitet.“ Was andererseits aber auch die zeitlichen Dimensionen eines Dilemmas zeigt.
Neben den 15 Bebauungsplänen, die 2023 festgesetzt wurden, gab es neun Änderungspläne. „Ob sie tatsächlich zusätzlich Wohnungsbau zulassen, müsste man im Einzelnen prüfen“, sagt Verwaltungsrechtler Haaß. Dies sei möglich, „aber nicht überwiegend wahrscheinlich“. Bei Änderungsplänen gehe es noch häufiger als bei neuen Bebauungsplänen darum, nach altem Recht zulässige Vorhaben für die Zukunft auszuschließen (beispielsweise Lebensmittelmärkte).
Mehr über Bebauungspläne hier:
„Die ideologisch getriebenen Baustadträte sind inzwischen ausgestorben, oder sie haben sich wieder eingefangen“, sagt der Insider aus der Projektentwicklerszene. Aber: Die Bezirkspolitik sei es gewohnt, dass den Investoren viel zugemutet wird. Hier eine Kita oder ein Spielplatz, dort eine Pflegeeinrichtung. „Der Bezirk selbst macht gar keine Bebauungspläne mehr, sondern lässt den Vorhabenträger vorlegen“, sagt der gebürtige Berliner.
Die Entwicklung zeigt, dass das vom BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen bereits 2021 beklagte Echo des schwierigen Neubauklimas noch immer nicht verhallt ist.
Damals nannte BBU-Vorständin Maren Kern als erste wichtige Schritte bei sinkenden Baugenehmigungszahlen „die Beschleunigung von Planungsverfahren, die digitale Stärkung der Verwaltung, den Ausbau des Verkehrsnetzes oder mehr bezahlbares Bauland, auch für Genossenschaften“. Ihr Verein setze darauf, dass das „Bündnis für Wohnungsneubau und bezahlbares Wohnen‘“ hierfür einen starken Rahmen schaffen werde.
8. „Bau-Turbo“ § 246e BauGB
ZEITENWENDE IN DER BAUPLANUNG
Die neue „Bau-Turbo“ Regelung
Die neuen Regelungen in § 246e BauGB ermöglichen es bis Ende 2030 in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt von den sonst geltenden planungsrechtlichen Vorschriften abzuweichen, sofern die Gemeinde zustimmt und das Vorhaben bestimmten wohnungspolitischen Zielen dient. Dabei wird das demokratische Planungsverfahren durch ein rein verwaltungsinternes Baugenehmigungsverfahren ersetzt.
Koordinierungsausschuss Innenstadt (KOAI)
Die neuen Regelungen § 246e erinnert in fataler Weise an den „Koordinierungsausschuss Innenstadt (KOAI) der 90er Jahre in Berlin.
Der Koordinierungsausschuss für innerstädtische Investitionen (KOAI) war ein informelles Beratungsgremium von Entscheidungsträgern verschiedener Berliner Senatsverwaltungen, der Treuhandanstalt, des Bundesfinanzministeriums und des Amtes für Regelungen offener Vermögensfragen. Zwischen 1991 und 1993 stimmte es in 14 Sitzungen die beschleunigte Vergabe innerstädtischer Filetgrundstücke an deutsch und internationale Investoren ab. Ohne demokratische Kontrolle und unter dem Radas der Öffentlichkeit entwickelte sich der KOAI zum zentralen Instrument mit dem „metropolendienliche“ Investitionen in die Ostberlin City-Bereiche gelenkt wurden. Insgesamt wurden 50 Großprojekte an den sonst üblichen Restitutionsverfahren und Planungsabläufen vorbei auf den Weg gebracht. Die Politik des KOAI stand für die Vision, Berlin zu einer „Europäischen Dienstleistungsmetropole“ zu entwickeln. (Karin Lenhard: „Bubble-politics’s in Berlin – Das Beispiel des Koordinierungsausschusses für innerstädtische Investitionen: eine ‚black box‘ als Macht- und Entscheidungszentrale‘, in: Prokla 110 (1998), S. 51 ff sowie eine gekürzte Fassung von Andrej Holm im Heft Arch+241 (2020) S. 101
Der Ansatz, Wohnungsbau durch vereinfachte Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, ist nachvollziehbar – gerade in Ballungsräumen mit hohem Bedarf. Allerdings wird hier das Kind mit dem Bade ausgeschüttet: An die Stelle eines demokratischen Planungsverfahrens nach § 30 BauGB tritt, das verwaltungsinterne Baugenehmigungsverfahren. Durch die unselige Kombination aus geringer Öffentlichkeit, Entscheidungszentrierung und wirtschaftlichem Interesse wird das Verfahren anfällig für Korruption. Der neue § 246 e unterläuft aber auch Bemühungen zur flächensparenden Stadtentwicklung. – der Druck auf die ohnehin knappen urbanen Grünflächen und ökologisch wertvolle Gebiete wird erhöht. Der wohnungspolitische Nutzen steht dabei in keinem angemessenen Verhältnis zum Flächenverbrauch. Effektiver wären flächensparende Maßnahmen wie die Nutzung von Baulücken und minder genutzten Baugrundstücken sowie eine gezielte Entwicklung des bisher eher vernachlässigten ländlichen Raums. Dazu bedürfte es allerdings entsprechender steuerlichen Regelungen/Anreize.
Der vom Bundestag am 9. Oktober 2025 verabschiedete § 246e BauGB hat folgenden Wortlaut:
„§ 246e Befristete Sonderregelung für den Wohnungsbau
(1) Mit Zustimmung der Gemeinde kann bis zum Ablauf des 31. Dezember 2030 von den Vorschriften dieses Gesetzbuchs oder den aufgrund dieses Gesetzbuchs erlassenen Vorschriften in erforderlichem Umfang abgewichen werden, wenn die Abweichung unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist und einem der folgenden Vorhaben dient:
der Errichtung Wohnzwecken dienender Gebäude,
der Erweiterung, Änderung oder Erneuerung zulässigerweise errichteter Gebäude, wenn hierdurch neue Wohnungen geschaffen oder vorhandener Wohnraum wieder nutzbar wird, oder
der Nutzungsänderung zulässigerweise errichteter baulicher Anlagen zu Wohnzwecken, einschließlich einer erforderlichen Änderung oder Erneuerung.
Eine Abweichung von Bauleitplänen ist insbesondere dann nicht mit öffentlichen Belangen vereinbar, wenn sie aufgrund einer überschlägigen Prüfung voraussichtlich zusätzliche erhebliche Umweltauswirkungen hat. Bei Vorhaben nach den Nummern 18.7 und 18.8 der Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung bleibt die Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung oder einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls unberührt.
(2) Für die Zustimmung der Gemeinde nach Absatz 1 Satz 1 gilt § 36a entsprechend.
(3) Im Außenbereich sind die Absätze 1 und 2 nur auf Vorhaben anzuwenden, die im räumlichen Zusammenhang mit Flächen stehen, die nach § 30 Absatz 1, Absatz 2 oder § 34 zu beurteilen sind. § 18 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 Satz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes ist anzuwenden.
(4) Die Befristung nach Absatz 1 Satz 1 bezieht sich nicht auf die Geltungsdauer einer Genehmigung,sondern auf den Zeitraum, bis zu dessen Ende im bauaufsichtlichen Verfahren von der Vorschrift Gebrauchgemacht werden kann.
(5) Wird ein Vorhaben nach Absatz 1 zugelassen, können in entsprechender Anwendung der Absätze 1 bis 4 auch den Bedürfnissen der Bewohner dienende Anlagen für soziale und kulturelle Zwecke zugelassen werden.“
Dazu passend, unsere Pressemitteilung vom 14.10.2025:
9. Krumme Geschäfte
BERLINER POLITFILZ UND KORRUPTIONSAFFÄREN
e(die heimlichen Könige AAKrumme Geschäfte: Berliner Polit-Filz und Korruptionsaffären
Das Dokument beleuchtet zahlreiche Beispiele von Korruption, Machtmissbrauch und Vetternwirtschaft in der Berliner Landespolitik seit den 1960er-Jahren bis in die Gegenwart. Im Zentrum steht die enge Verflechtung zwischen Politik und Bauwirtschaft – stets unter dem Motto: „Man kennt sich, man hilft sich.“
Wichtige Fälle und Affären:
- Steglitzer Kreisel (1968–heute):
Prestigeprojekt von Architektin Sigrid Kressmann-Zschach.
Massiver Einsatz öffentlicher Mittel, Bürgschaften über 70 Mio. Mark.
Insolvenz, Asbestverseuchung, jahrelanger Leerstand.
Luxussanierung durch Investor Christoph Gröner (CG Gruppe), doch Fertigstellung verzögert sich bis mindestens 2026.
Projekt ist Paradebeispiel für politische Seilschaften und Missmanagement. - Garski-Affäre (1981):
Bauunternehmer erhielt Bürgschaften von 112 Mio. DM für Auslandsgeschäfte.
Nach Insolvenz Rücktritt mehrerer Senatoren, Sturz des Regierenden Bürgermeisters Dietrich Stobbe (SPD).
Symbol für Zusammenbruch von Machtstrukturen durch Intransparenz. - Antes-Skandal (1986):
CDU-Baustadtrat Wolfgang Antes nahm Bestechungsgelder in Höhe mehrerer Hunderttausend Mark.
Auch CDU-Kollege Herrmann und ein Bordellbesitzer verwickelt.
Haftstrafen, Aufdeckung eines Netzwerks aus Politik und Bauunternehmern. - Berliner Bankenskandal (2001):
Zusammenbruch der Bankgesellschaft Berlin AG.
Land Berlin übernahm Risiken bis zu 21,6 Mrd. Euro.
Vorteilsgewährung für Politiker, Prominente und Bankmanager.
Sturz von Bürgermeister Eberhard Diepgen (CDU). - Tempodrom-Affäre (2004):
Projekt des SPD-Bausenators Peter Strieder kostete doppelt so viel wie geplant.
Strieder musste zurücktreten, obwohl er zuvor politisch von ähnlichen Skandalen profitierte.
Strukturelle Probleme und aktuelle Entwicklungen:
- Antikorruptionsarbeit in Berlin:
- Fehlende Daten und systematisches Lagebild.
- 2024: 48 Korruptionsfälle erfasst, vor allem wegen Bestechung.
- Anonyme Hinweisgeberstelle seit 2015 aktiv.
- Bauplanungsrecht und Korruption:
- Gerichtsurteile erleichtern Dachausbauten, da alte Pläne funktionslos geworden sind.
- § 246e BauGB erlaubt bis Ende 2027 Ausnahmen vom Planungsrecht zur Wohnraumbeschaffung.
- Gefahren durch neue Gesetzgebung:
- Geringe Transparenz, Entscheidungszentrierung, Einfluss wirtschaftlich starker Investoren.
- Beispiel: mögliche Bebauung des Großen Tiergartens in Berlin.
- Appell: Gesetzlichen Schutz urbaner Grünflächen ausbauen, z. B. über das Volksbegehren 100% Großer Tiergarten.
Der Zusammenhang zwischen dem neuen § 246e BauGB und dem bekannten Berliner Polit-Filz lässt sich präzise unter dem Motto „Man kennt sich, man hilft sich“ zusammenfassen – ein Satz, der seit Jahrzehnten die inoffizielle Geschäftsordnung zahlreicher Berliner Bauprojekte beschreibt.
Historischer Kontext: Berliner Baufilz als systemisches Problem
Berlin ist seit den 1960er Jahren immer wieder Schauplatz teils spektakulärer Korruptionsaffären gewesen, insbesondere im Zusammenhang mit Bauprojekten. Beispiele sind:
Steglitzer Kreisel: Milliardenverluste durch politisch gedeckte Fehlentscheidungen, enge Verbindungen zwischen Investoren und Politik.
Garski-Affäre: Politisch unterstützte Bürgschaften in dreistelliger Millionenhöhe für private Bauprojekte – späterer Zusammenbruch.
Antes-Skandal: CDU-Baustadtrat nahm Bestechungsgelder für Baugenehmigungen – Haftstrafen für mehrere Beteiligte.
Bankenskandal: Intransparente Immobilienfonds mit Rückendeckung aus Politik – Milliardenlast für Berlin.
In fast allen Fällen ist ein strukturelles Muster erkennbar:
Entscheidungen zugunsten wirtschaftlich starker Akteure wurden ohne ausreichende demokratische Kontrolle getroffen – in einem Klima politischer Kumpanei und gegenseitiger Gefälligkeiten.
§ 246e BauGB – Rückfall in alte Muster?
Die neue Regelung (§ 246e BauGB) erlaubt bis 2030 in angespannten Wohnungsmärkten Abweichungen vom sonst bindenden Bauplanungsrecht – ohne reguläres, demokratisches Planungsverfahren. Stattdessen entscheidet intern die Verwaltung, mit Zustimmung der Kommune, über Projekte ab sechs Wohneinheiten.
Diese Regelung birgt exakt die Risiken, die Berlin in der Vergangenheit teuer zu stehen kamen:
|
Risiko |
Erklärung |
Parallelen zur Vergangenheit |
|
Intransparenz |
Keine Öffentlichkeit, keine Bürgerbeteiligung |
Wie beim Steglitzer Kreisel oder der Bankgesellschaft: Deals im Hintergrund |
|
Vetternwirtschaft |
Entscheidungsmacht bei wenigen Personen (z. B. Bürgermeister, Amtsleiter) |
„Man kennt sich, man hilft sich“ – politische und persönliche Netzwerke entscheiden |
|
Machtkonzentration |
Investoren können durch gezielte Kontakte Einfluss nehmen |
Analog zu SKZ, Garski, Antes – direkter Draht zur Verwaltung zahlt sich aus |
|
Fehlende fachliche Kontrolle |
Umwelt- und Fachprüfungen nur am Rand berücksichtigt |
Wie bei früheren Baugroßprojekten – Nebenwirkungen werden ignoriert oder verharmlost |
„Freie Fahrt für die Freunde“?
In der Praxis bedeutet § 246e BauGB:
Wer über die richtigen Kontakte verfügt, kann schneller, günstiger und großzügiger bauen – auch gegen öffentliche Interessen wie Grünflächenerhalt, Nachbarschutz oder Umweltstandards.
Besonders kritisch: Auch sensible Grünflächen wie den Große Tiergarten könnten potenziell ins Visier geraten, wenn der politische Wille fehlt, sie dauerhaft zu schützen.
Fazit: § 246e BauGB = institutionalisierte Intransparenz?
Wenn man die Berliner Vergangenheit kennt, muss § 246e als Gefahr für rechtsstaatliche Stadtentwicklung gesehen werden:
Er öffnet Schlupflöcher für Klientelpolitik.
Er entzieht Bauprojekte demokratischer Kontrolle.
Er befördert die alten Berliner Strukturen von „Filz, Kumpanei und Gefälligkeit“.
Der Satz „Man kennt sich, man hilft sich“ könnte durch § 246e wieder zur arbeitsalltäglichen Praxis in den Bauverwaltungen werden – diesmal legitimiert durch Bundesgesetz.
Fazit:
Die Berliner Stadtgeschichte ist von wiederkehrenden Korruptionsskandalen geprägt. Politisch motivierte Entscheidungen zugunsten Einzelner haben das Vertrauen in Institutionen geschwächt. Strukturelle Schwächen wie mangelnde Transparenz, Parteibuchwirtschaft und unzureichende Kontrollmechanismen bestehen weiterhin. Ein Paradigmenwechsel hin zu demokratischer Kontrolle und rechtssicherem Umweltschutz wird dringend gefordert.
Unsere Forderung: Am Ende jeder Wahlperiode wechsel die Amtsleiter der Bau-/Planungsbehörden (die heimlichen Könige im Immobiliengeschäft auf Seite der Verwaltung) in andere Bezirk.
MAN KENNT SICH, MAN HILFT SICH – BERLINER GESCHICHTEN
!Aus der Vergangenheit für Gegenwart und Zukunft lernen
Man könnte annehmen, dass Niemand die Absicht hat, Grünflächen zu bebauen!“ Wirklich niemand und niemals? Zweifel an der Glaubwürdigkeit von Politik und Verwaltung kommen auf, denkt man an die Berliner Polit-Filz Tradition, also die gewinn- und skandalträchtigen Verbindungen von politischem Einfluss und privaten Geschäftsinteressen nach dem Motto: „Man kennt sich, man hilft sich.“
Da wurden Entwicklungen angestoßen, die letztlich nicht mehr zu kontrollieren waren. Warum nicht auch eines Tages im Großen Tiergarten?
Fangen wir aber mit dem an, was war, um daraus schlussfolgernd das zu tun, was notwendig ist: rechtzeitig Vorsorge für den dauerhaften Erhalt des Großen Tiergartens zu treffen:
Der Steglitzer Kreisel
Der Steglitzer Kreisel(1), dessen Bau 1968 begonnen wurde, markiert den ersten Höhepunkt des Berliner Polit-Filzes in der Nachkriegszeit. Die Architektin des Kreisels, Sigrid Kressmann-Zschach, hatte alles richtig gemacht: In den fünfziger Jahren aus Leipzig nach Berlin-West gekommen, heiratete sie 1960 den Kreuzberger Bezirksbürgermeister Willy Kressmann, ein Sozialdemokrat – wie damals so ziemlich alle wichtigen Leute. Kressmann brachte sie mit der Berliner Gesellschaft zusammen – „plötzlich ist man drin“, sagte Sigrid Kressmann-Zschach später.
Drin zu sein, bedeutete vor allem: Informationen zu bekommen, zu großen Bauvorhaben etwa. Und Sigrid Kressmann-Zschach (SKZ) dachte und plante groß: Sie erwarb über Scheinfirmen die Optionen zum Kauf privater Grundstücke an dem Standort und trommelte beim späteren Kanzleramtschef Horst Grabert (SPD) für ihre Pläne der Errichtung eines Einkaufzentrums und eines riesigen Wolkenkratzers nahe des geplanten U-Bahnkreuzes.
Über eine leichthin vergebende Bürgschaft in Höhe von 42 Millionen Mark stolperten Finanzsenator Heinz Striek (SPD) und Bausenator Rolf Schwedler (SPD). Als diese Bürgschaften nämlich sechs Jahre nach Baubeginn, also 1974, fällig wurden, meldete „Avalon“, das Unternehmen von SKZ wegen ausbleibender Interessenten und stetig steigender Kosten Insolvenz an. In der „Kreisel-Affäre“ ermittelte die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des Betruges – stellte die Ermittlungen aber 1975 ein. Die Bauarbeiten am Kreisel waren unterdessen seit 1972 zu einem Stillstand gekommen.
Das Land verlor mehr als 40 Millionen Mark, die es als Berlin-Kredit gewährt hatte, musste die Bürgschaft für mehr als 30 Millionen Mark einlösen und hatte eine weitere Investitionszulage aus Steuergeldern in Höhe von 22 Millionen Mark gewährt.
1977 fand sich mit der Immobilienfirma „Becker & Kries“ ein neuer Gesellschafter für das Bauprojekt. 1980 wurde der Turm – nach zwölf Jahren Bauzeit – fertiggestellt. Die Kosten für den Kreisel waren auf 323 Millionen Mark angewachsen, und statt der erhofften Bürovermietung bezogen die Mitarbeiter des nahegelegenen Bezirksamtes den Koloss von Steglitz.
1990 kaufte der Bezirk den Steglitzer schließlich den Turm für 67 Millionen D-Mark.
Der Sockelbau verblieb bei der Immobilienfirma „Becker & Kries“. Dass es ein Asbestproblem in den Fluren und Luftschächten des Amtsgebäudes geben könnte, ahnte man da bereits. Wenige Wochen nach dem Kaufabschluss, wurde die Schadstoffbelastung offiziell bestätigt: Der Turm war durch und durch mit der hochgefährlichen Faser verseucht.
Statt einer kostenintensiven Sanierung schlug man sich in den Folgejahren mit Flickwerk durch: Nur bei auftretenden Gebäudeschäden erfolgte eine Schadstoffbeseitigung, bis ein Im Oktober 2004 Gutachten offenbarte ein Gutachten das ganze Ausmaß der Asbestbelastung. Die Sanierungskosten wurden auf 75 Millionen Euro geschätzt.
Daraufhin beschloss der Berliner Senat 2006, das Bürohochhaus aufzugeben und die dort beschäftigten Mitarbeiter in anderen landeseigenen Immobilien unterzubringen. Der Umzug und die nötigen Umbauten verschlangen 15 Millionen Euro. Im November 2007 verließen die letzten Beschäftigten des Bezirksamtes das Gebäude und das Haus fiel in einen jahrzehntelangen Dornröschenschlaf – nur unterbrochen von der Schadstoffsanierung.
Erfolglos versuchte der damalige Finanzsenator Thilo Sarrazin (SPD) die Liegenschaft auf dem Immobilienmarkt anzubieten. Doch die potentiellen Käufer schreckte die hohe Investitionssumme, die für die Asbestbeseitigung im Raum stand. Ein Abriss wurde ebenfalls erwogen, war in der Öffentlichkeit aber schwer vermittelbar.
Angesichts der jährlichen Kosten von rund 700.000 Euro für den unbenutzten Steglitzer Kreisel wurden die Lösungsvorschläge mit der Zeit kreativer: 2010 bot der Senat den asbestverseuchten Turm auf der internationalen Immobilienmesse in Cannes an –mit mäßigem Erfolg.
2012 kam der Vorschlag ins Spiel, den Turm als Lagerhaus zu nutzen sowie eine Begegnungsstätte für jüdische Kultur mit Restaurant einzurichten. Währenddessen verfiel die Bausubstanz des zu einer modernen Ruine verkommenen Turms immer weiter. Eine Lösung musste her.
In den 2010er-Jahren kam die vermeintliche Rettung: Die CG Gruppe des Investors Christoph Gröner – bekannt durch großzügige Spenden an die Berliner CDU – zeigte ein Kaufinteresse an der einstigen Prestigeimmobilie.
Zunächst sollte der Senat aber die Asbestsanierung für das Gebäude übernehmen. Seit 2013 wurden die krebserzeugenden Schadstoffe im Steglitzer Kreisel aufwendig beseitigt. Nachdem die letzten Arbeiten nach einigen Verzögerungen 2017 abgeschlossen werden konnten, wurde der Kauf besiegelt und die Immobilienfirma übernahm den Turm.
Bereits 2015 hatte die CG Gruppe den Sockelbau des Steglitzer Kreisels gekauft und nun das ganze Bauensemble in einer Hand.
Ihr Ziel: ein Umbau des Bürogebäudes zu einem Hochhaus mit knapp 330 Wohneinheiten, davon 262 im Turm und 67 in der zweiten und dritten Etage des Sockels. In den unteren Geschossen sollten eher kleine Apartments ab etwa 30 Quadratmetern für Studenten oder Singles entstehen. In den oberen Etagen des Hochhauses herrschte nach den Bauplänen dagegen purer Luxus: Penthouses sollten gutbetuchtes Klientel anziehen und jeweils mehrere Millionen Euro Kaufpreis erzielen. Für die Vermarktung wurde das Hochhaus „ÜBerlin Tower“ getauft.
Bis heute soll knapp die Hälfte der geplanten Wohnungen inklusive der Edelwohnungen an der Hochhausspitze verkauft oder reserviert sein – doch auf die Schlüssel zu ihrer Wohnung warteten die Käufer vergebens.
Im Jahr 2017 machte sich die CG Gruppe daran, mit den Umbauarbeiten zu beginnen: Der Turm wurde eingerüstet, mit Bauplanen verhangen und das Gebäude bis auf das Stahlgerüst entkernt – doch die Arbeiten kamen bald ins Stocken und die Fertigstellung wurde immer weiter hinausgeschoben.
Die Einweihung des neuen Wohntowers war ursprünglich für 2020 angepeilt. Doch nach anfänglichen Enthusiasmus tat sich wenig auf der Endlosbaustelle.
Schließlich bewegte sich der Baukran nur noch im Wind und augenfällige Fortschritte konnten Passanten an der Umbauruine nicht mehr feststellen. Einmal mehr hatte sich der Steglitzer Kreisel von einem Hoffnungsträger zu einem Berliner Baufiasko entwickelt. Der früheste Einzugstermin wurde auf 2021 und 2022 verschoben, dann auf 2024, 2025 und jüngst auf 2026.
Vor Gericht erstritten Wohnungskäufer, dass die ursprünglich vereinbarten Konditionen eingehalten werden müssen. Inzwischen war die CG-Gruppe von der Consus Real Estate AG geschluckt worden, die ihrerseits in die Adler Group aufging.
Die angeschlagene Adler Group scheint sich am liebsten komplett von dem Projekt verabschieden zu wollen. Turm und Sockel sollen verkauft werden. Die Zukunft des Bauprojekts? Ungewiss.(2)
Garski-Äffäre
Über die „Garski-Äffäre“(3) 1981 stürzte gleich ein ganzer Senat mitsamt dem regierenden Bürgermeister Dietrich Stobb (SPD). Auch Garski war einer, der gern groß dachte. Für seine Bauprojekte in Saudi-Arabien hatte der Architekt und Unternehmer Senatsbürgschaften lockermachen können, am Ende 112 Millionen Euro. Weil die Projekte sich nicht so entwickelten, wie Garski und seine politischen Freunde sich das erhofft hatten, waren immer mal wieder Gespräche mit Finanzsenator Klaus Riebschläger (SPD) und schließlich auch mit dem Regierenden Stobbe notwendig. Der legte nach. Dann, Ende 1980, war die Landesbürgschaft in voller Höhe fällig, denn Garskis Firma war insolvent.
Mitte Januar 1981 machte die CDU-Fraktion die Sache zum Thema. Riebschläger und FDP-Wirtschaftsenator Wolfgang Lüder traten zurück. Stobbe holte sich neue Senatoren, pokerte um die Macht und verlor. Seine neuen Senatoren überstanden die notwendigen einzelnen Abstimmungen nicht.
„Machtzerfall“ hieß später ein Buch über das einstweilige Ende der SPD-Herrschaft über West-Berlin. Denn das ist die Voraussetzung für verfilzte Politik: Dass in den Senatsverwaltungen und den Behörden ein Klima entsteht, das menschliche Nähe fördert, in dem Sinn: Wenn es dem Parteifreund nutzt, wird es mir nicht schaden. In der CDU haben sie das schnell verstanden.
Der Antes Skandal(4)
Der West-Berliner Filz war, wie sich bald zeigen sollte, ein Mischprodukt aus rotem und schwarzem Gewebe. Nachdem Richard von Weizsäcker (CDU), Regierender Bürgermeister von 1981 bis 1984, den Niederungen der Landespolitik entkommen war, dauerte es bloß ein gutes Jahr, bis ein paar CDU-Politiker wegen fortgeschrittenem Vetternwirtschaft ins Gerede kamen: der Skandal um den Charlottenburger Baustadtrat Wolfgang Antes (CDU).
Ein Zufallsfund hatte Berliner Polizisten auf Antes’ Spur gebracht. Der Baustadtrat hatte sich mit einigen hunderttausend D-Mark bestechen lassen und das mit Gefälligkeiten vor allem gegenüber Bekannten aus der Baubranche vergolten.
Ein weiterer Parteifreund, der Wilmersdorfer Baustadtrat Jörg Herrmann, geriet ebenfalls in den Blick der Justiz, und auch ein „Bordell-König“ namens Otto Schwanz spielte eine tragende Rolle.1986 befassten sich Kripo-Ermittler mit einem Komplex, in den 29 Beschuldigte verwickelt waren, CDU-Mitglieder, Bauunternehmer und Leute, die aus dem Entmieten und Aufhübschen von Altbauten ein Geschäft gemacht hatten und ihre Streitigkeiten gern mit Gewalt austrugen.
Diesmal war es nicht mit ein paar Rücktritten getan: Antes und Herrmann wurden wegen Bestechlichkeit und Vorteilsnahme zu Haft verurteilt, Schwanz wegen Bestechung und einigen anderen Delikten.
Berliner Bankenskandal
Berliner Bankenskandal(5) ist die Bezeichnung für eine folgenschwere Bankenkrise in Berlin im Jahr 2001. Die Vorgänge um die landeseigene Bankgesellschaft Berlin AG, bezeichnet die Vorgänge rund um die landeseigene Bankgesellschaft Berlin AG, deren wirtschaftlicher Zusammenbruch das Land Berlin in Milliardenhöhe weiter verschuldete.
„Der Bankenskandal führte nach einem Jahrzehnt zum Ende der Großen Koalition und im Juni 2001 zum Sturz des Regierenden Bürgermeisters Eberhard Diepgen.
Der Bankenskandal begann und baute sich dann langsam auf mit dem Mauerfall 1989. Durch den Mauerfall verloren Ost- und Westberlin ihre subventionierten Sonderrollen: Als erstes stoppte die Regierung unter Helmut Kohl 1990 alle Berlin-Hilfen(6).
Mit den fehlenden Bundesmittel im Berliner Haushalt startete die Finanzkrise Berlins. Als nächstes sanken auch noch die Wohnungsmieten aufgrund des Überangebots an preiswertem Wohnraum im Osten von Berlin bis hin zu einem nicht zu übersehenden Wohnungsleerstand.
Dadurch kamen die Berliner Immobilienpreise ins Trudeln und mit ihnen die von der Bankgesellschaft Berlin AG herausgegebenen Immobilienfonds. Kein Problem für Kapitalanleger zumal, wenn sie der Einladung der Bankgesellschaft Berlin AG gefolgt waren.
Die Bankgesellschaft Berlin AG bot Immobilienfonds mit sehr günstigen Konditionen Kapitalanleger aus aller Welt an. Die Bankgesellschaft Berlin AG lockte mit hohen Mietzinsgarantien (selbst falls die Immobilie leer stehen sollte), mit extrem langen Laufzeiten (25 bzw. 30 Jahre) und am Ende mit einer Rückzahlungsgarantie.
Ob diese Konstruktion mit geltendem Recht vereinbar war, wurde niemals überprüft.
Durch die rechtliche Konstruktion der Bankgesellschaft Berlin AG bürgte letztendlich das Land Berlin für diese tollkühnen Versprechen. Im Frühjahr 2000 platzte die Spekulationsblase. Im Zuge des darauffolgenden Bankenskandals gab der Fraktionsvorsitzende der CDU im Abgeordnetenhaus Klaus-Rüdiger Landowsky, gleichzeitig auch Vorstandschef der Berliner Hyp AG, eine Tochter der Berliner Bankgesellschaft AG, beide Ämter auf. Im Juni 2001 wurde der Regierende Bürgermeister Eberhard Diepgen (CDU) durch ein Misstrauensvotum gestürzt.
In den folgenden Monaten kam nach und nach das Ausmaß der Gesetzesverstöße zum Vorschein. So wurden seit langem und systematisch Verluste über Netzwerke von Strohmännern verborgen, Risiken aus Geschäften wurden mit dubiosen Verträgen auf das Land Berlin abgewälzt. Für einen ausgewählten Personenkreis (vor allem Prominente, Mitglieder der Regierungsparteien CDU und SPD, Bankmanagern sowie deren Bekanntenkreis) wurden Sonderfonds angeboten, deren Konditionen noch wesentlich besser als die der normalen Immobilienfonds waren.
Weiterhin gab es hohe Abfindungen und Renten für die entlassenen Bankmanager sowie Verträge mit unangemessenen Mieten für bankeigene Villen, die von den Managern genutzt wurden. Auch die kostenlose Renovierung mehrerer dieser Villen kam ans Licht. Im April 2002 beschloss das Abgeordnetenhaus mit der Mehrheit der neuen SPD/PDS-Regierung unter Klaus Wowereit (SPD), dass das Land Risiken aus dem Immobiliengeschäft in Höhe von bis zu 21,6 Milliarden Euro übernimmt.“(7)
Berliner Bankenskandal bleibt straffrei!
Der Hauptverantwortliche für den Berliner Bankenskandal kommt straffrei davon: Der Prozess gegen Klaus-Rüdiger Landowsky wurde eingestellt. „Die etwaige Schuld ist gering und ein öffentliches Interesse an einer Strafverfolgung besteht nicht mehr“, stellte das Berliner Landgericht fest. Als Reaktion auf die zuvor eingeholte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hatten die Justizminister der Länder bereits 2011 eine Verschärfung des Strafrechts gefordert: Eine gravierende Pflichtverletzung von Bankmanagern sollte bereits für sich genommen strafbar sein. Doch weder die schwarz-gelbe noch die schwarz-rote Koalition auf Bundesebene griffen diese Initiative auf. Warum? Die TAZ hat’s (8)
Die Tempodrom-Affäre
Wie verwoben schwarzer und roter Filz in Berlin sind, zeigte sich, zwischendurch gewissermaßen, an der „Tempodrom-Affäre“(9): Bausenator Peter Strieder (SPD) stürzte über das Kreuzberger Bauprojekt, mit dem er renommiert hatte.
2004 gab Strieder auf – da war das Tempodrom ungefähr doppelt so teuer geworden wie angekündigt. Das Delikate an Strieders Rücktritt lag darin, dass hier einer über eine Affäre stürzte, nachdem er selbst den Skandal zuvor politisch perfekt genutzt hatte: Es war Strieder, der gemeinsam mit Klaus Wowereit den Bankenskandal instrumentalisiert hatte, um die CDU als korrupt und verkommen darzustellen und die SPD aus der Knechtschaft des kleineren Koalitionspartners an die Macht zu führen. Die Sozialdemokraten sprachen damals selbstbewusst von einem „Mentalitätswechsel“.
Licht in den Berliner Sumpf bringen(10)
Der Antikorruptionsverein Berlin hatte 2019 eine Petition 2019 beim Abgeordnetenhaus eingereicht und verwiest auf den bekannten „Berliner Sumpf“. „Bisher gibt es praktisch keine Daten zur Korruption in Berlin. Man weiß im Grunde nichts über das Ausmaß“, sagt Vereinsvorstand Jiri Kandeler. „Ein Lagebild wäre ein erster Schritt, das Dunkelfeld überhaupt einmal ein wenig zu erhellen und die Korruptionsbekämpfung zu optimieren.“(11)
Am 11.1.2024 teilte die Senatsverwaltung für Inneres und Sport mit, dass „48 Ermittlungskomplexe erfasst (wurden), die der Korruptionskriminalität zuzurechnen sind.
Den deliktischen Schwerpunkt bildete mit 27 Fällen der Tatvorwurf der Bestechung. Es wurden 53 Tatverdächtige ermittelt, von denen 15 als Vorteilsnehmende bzw. Bestochene („Nehmende“) und 38 als Vorteilsgewährende bzw. Bestechende („Gebende“) auftraten.
Neben wirtschaftlichen und monetären Schäden zeichnen sich Korruptionsstraftaten vor allem durch immaterielle Schäden aus. Hierzu zählt der Verlust des Vertrauens in die Unbestechlichkeit und Handlungsfähigkeit staatlicher Institutionen sowie die Integrität der Wirtschaft.
In keinem der Ermittlungskomplexe des vorliegenden Berichtsjahres konnte ein konkret zu bezeichnender finanzieller Schaden ermittelt werden. Der Phänomenbereich verzeichnet erfahrungsgemäß ein enorm hohes Dunkelfeld, da es bei Korruptionsstraftaten nur Täterinnen und Täter gibt, die beiderseits kein Interesse an einer Strafverfolgung haben.
Vor diesem Hintergrund kommt der Korruptionsprävention eine besondere Bedeutung zu.
Sie ist in erster Linie die Aufgabe von Innenrevisionen in Behörden und Compliance-Abteilungen von Unternehmen. Dort gilt es, korruptionsgefährdete Bereiche und Arbeitsprozesse zu identifizieren, wirksame Maßnahmen zur Prävention zu entwickeln und deren Umsetzung zu kontrollieren.
Im Jahr 2015 wurde die Anonyme Hinweisgeberstelle Korruption beim Landeskriminalamt Berlin eingerichtet. Sie bietet der Öffentlichkeit eine niedrigschwellige Möglichkeit, Hinweise auf Korruptionsdelikte zu 100 % anonym über ein Hinweisgebersystem zu übermitteln.
Mehr Prävention gegen unangemessenes Verhandeln bei Baugenehmigungsverfahren(12)
Aufsehen erregte in der Fachwelt ein Urteil des OVG Berlin-Brandenburg von Okt. 2020. Das Urteil betrifft die bauplanungsrechtliche Beurteilung bei verdichtungsmaßnahmen im Bereich des Baunutzungsplans, eine Berliner Besonderheit: Der noch heute gültige Baunutzungsplan für den damaligen Westteil der Stadt, wurde in den Jahren 1958/60 kurz vor in Kraft treten des Bundesbaugesetz (BauGB), aufgestellt und ist heute noch rechtsgültig. Es spiegelt die damaligen Planungsvorstellung einer aufgelockerten, gegliederten Stadt wieder, die ganz im Gegensatz steht zur politisch gewollten „Verdichtung“ der Stadt (zum Schutz vor Zersiedelung auf der „grünen Wiese“).
Das OVG Berlin-Brandenburg hat nun bestätigt, dass der Baunutzungsplan hinsichtlich der festgesetzten Geschossflächenzahl in einem Teilbereich von Neukölln funktionslos geworden ist. Durch Ausnahmeregelungen haben sich Quartierssilhouetten im Laufe der Jahrzehnte stark verändert: Viele Altbauten wurden im Laufe der Jahre aufgestockt, Neubauten gleich höher angelegt als Benachbartes. (Da waren also andere Bauherren mit ihren Architekten schon vorher erfolgreich. Zu welchem Preis bleibt unbekannt.)
Es ist davon auszugehen, dass auch in anderen Innenstadtbezirken (Tempelhof-Schöneberg, Mitte, Charlottenburg-Wilmersdorf) entsprechend entschieden werden wird. Damit besteht nach Paragraf 34 Baugesetzbuch nunmehr ein Anspruch auf die Genehmigung von Vorhaben, die sich „in die nähere Umgebung einfügen“.
Einen Ermessensspielraum – wie bei Befreiungen von der geschoßflächenzahl – hat die Behörde nicht. Mit anderen Worten: Dachgeschossausbauten werden durch die Entscheidungen erheblich erleichtert. Dachgeschossausbauten werden nun leichter.
Befreiungen von der Geschoßflächenzahl verbanden die Bezirke bisher gerne mit detaillierten Wünschen, sagt Rechtsanwalt Axel Dyroff (Kanzlei Seldeneck und Partner), der die Urteile vor dem OVG erstritt: „Man hat eine Verdichtung zugelassen, wenn der Bauherr Ausgleichsersatzmaßnahmen angeboten hat. Mal ging es um eine bestimmte Balkongestaltung, mal um Stellplätze. Wer weiß, worum noch? Immer stand die Befreiung von der Regel im Ermessen der Behörden. Das ist nun vorbei“.
Aber auch die Auslegung des § 34 BauGB ist dehnbar und zementiert zudem nur das, was schon war. Ein Aufbruch in einen klimagerechten Stadtumbau – und damit in einen Paradigmenwechsel – wird hingegen nur mit Hilfe der Bauleitplanung möglich sein. Doch auch damit sieht es nicht gut aus, siehe: Kapitel „Bau-Turbo“ § 246e BauGB – der Niedergang konzeptioneller Bauleitplanung setzt sich fort.
§ 246e BauGB – kein guter Tag für den Großen Tiergarten und alle anderen urbanen Grünflächen.
Die neuen Regelungen in § 246e BauGB ermöglichen es bis voraussichtlich(!) Ende 2027 in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt von den sonst geltenden planungsrechtlichen Vorschriften abzuweichen, sofern die Gemeinde zustimmt und das Vorhaben bestimmten wohnungspolitischen Zielen dient. Dabei wird das demokratische Planungsverfahren durch ein rein verwaltungsinternes Baugenehmigungsverfahren ersetzt.(68)
Koordinierungsausschuss Innenstadt (KOAI)
Die neuen Regelungen § 246e erinnert in fataler Weise an den „Koordinierungsausschuss Innenstadt (KOAI) der 90er Jahre in Berlin.
Der Koordinierungsausschuss für innerstädtische Investitionen (KOAI) war ein informelles Beratungsgremium von Entscheidungsträgern verschiedener Berliner Senatsverwaltungen, der Treuhandanstalt, des Bundesfinanzministeriums und des Amtes für Regelungen offener Vermögensfragen.
Zwischen 1991 und 1993 stimmte es in 14 Sitzungen die beschleunigte Vergabe innerstädtischer Filetgrundstücke an deutsch und internationale Investoren ab. Ohne demokratische Kontrolle und unter dem Radas der Öffentlichkeit entwickelte sich der KOAI zum zentralen Instrument mit dem „metropolendienliche“ Investitionen in die Ostberlin City-Bereiche gelenkt wurden.
Insgesamt wurden 50 Großprojekte an den sonst üblichen Restitutionsverfahren und Planungsabläufen vorbei auf den Weg gebracht. Die Politik des KOAI stand für die Vision, Berlin zu einer „Europäischen Dienstleistungsmetropole“ zu entwickeln. (Karin Lenhard: „Bubble-politics’s in Berlin – Das Beispiel des Koordinierungsausschusses für innerstädtische Investitionen: eine ‚black box‘ als Macht- und Entscheidungszentrale‘, in: Prokla 110 (1998), S. 51 ff sowie eine gekürzte Fassung von Andrej Holm im Heft Arch+241 (2020) S. 101
Der Ansatz, Wohnungsbau durch vereinfachte Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, ist zwar nachvollziehbar – gerade in Ballungsräumen mit hohem Wohnungsbedarf, aber hier wird das Kind mit dem Bade ausgeschüttet: An die Stelle eines demokratischen Planungsverfahrens nach § 30 BauGB tritt, das verwaltungsinterne Baugenehmigungsverfahren.
Durch die unselige Kombination aus geringer Öffentlichkeit, Entscheidungszentrierung und wirtschaftlichem Interesse wird das Verfahren anfällig für Korruption.
Das neue Verfahren könnte in mehreren Punkten anfällig für Korruption sein:
- Reduzierte Transparenz
Wenn demokratische Planungsverfahren – inklusive Öffentlichkeitsbeteiligung, Offenlage und Anhörung – durch verwaltungsinterne Genehmigungen ersetzt werden, sinkt die Transparenz erheblich.
Das erhöht das Risiko, dass Entscheidungen nicht mehr nachvollziehbar oder willkürlich getroffen werden können. - Erhöhte Entscheidungsmacht einzelner Akteure
Die Verantwortung für die Zustimmung liegt primär bei der Gemeinde (§ 36 Abs. 2 Satz 2 BauGB). Wenn dabei keine öffentlichen Gremien einbezogen werden, sondern z. B. nur der Bürgermeister oder einzelne Amtsträger entscheiden, sind der persönlicher Vorteilsnahme Tür und Tor geöffnet. - Begünstigung wirtschaftlich starker Investoren
Bauvorhaben ab sechs Wohnungen sind privilegiert. Große Investoren könnten durch Lobbying oder Einflussnahme auf kommunale Entscheidungsträger eine bevorzugte Behandlung erhalten – auf Kosten öffentlicher Belange oder kleinerer Bauherren. - Reduzierte Kontrolle durch Umwelt- und Fachbehörden
Auch wenn einzelne Prüfpflichten – wie die gesetzlich vorgeschriebene Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) – erhalten bleiben, werden sie unter Umständen nicht mehr im Zusammenhang eines umfassenden Planverfahrens eingebunden. Das kann den Weg öffnen für unvollständige oder nachlässige Prüfung.. - Zeitdruck als Katalysator
Die Befristung des Gesetzes auf 2027 erzeugt politischen und wirtschaftlichen Druck, möglichst viele Projekte kurzfristig durchzuwinken. In einem solchen Klima ist die Versuchung groß, Verfahren zu beschleunigen, auch wenn es dabei zu Unregelmäßigkeiten kommt.
Dem Gesetzentwurf § 246e BauGB soll im Herbst 2025 von der CDU-SPD Koalition zugestimmt werden. Kein guter Tag für den Großen Tiergarten und alle anderen urbanen Grünflächen.
Fazit:
Die Berliner Stadtgeschichte ist von wiederkehrenden Korruptionsskandalen geprägt.
Politisch motivierte Entscheidungen zugunsten Einzelner haben das Vertrauen in Institutionen geschwächt. Strukturelle Schwächen wie mangelnde Transparenz, Parteibuchwirtschaft und unzureichende Kontrollmechanismen bestehen weiterhin. Die Gefahr, dass sich eines Tages doch die Kräne im Großen Tiergarten drehen, obwohl das niemand wollte, ist gegeben.
Beklagt würden dann im Nachhinein – wie so oft – Versäumnisse der vorherigen Regierungen und Sachzwänge. Wieder hervorgerufen durch intransparente Verfahren, Ämterpatronage und Parteibuchwirtschaft.
Gegenüber derartiger Fehlentwicklung heißt es stets wachsam sein. Im Sinne der Vorsorge ist es erforderlich, schon hier und heute die notwendigen Entscheidungen zum dauerhaften und vollumfänglichen Erhalt des Großen Tiergartens zu treffen.
Deshalb muss das Grünanlagengesetz per Volksbegehren jetzt ergänzt werden um den dauerhaften Schutz des Großen Tiergartens im dauerhaften Eigentum des Lanes Berlin zu gewährleisten. Wer dann den Großen Tiergarten anfasst, muss zuerst in aller Öffentlichkeit im Abgeordnetenhaus das Grünanlagengesetz ändern (lassen). Und das ist gut so!
(1) Alle Angaben zum Steglitzer Kreisel auf Basis der Artikel „Die Skandal-Story des Steglitzer Kreisels ist haarsträubend“, Berliner Morgenpost vom 18.04.2024, und „Politische Affären und Skandale: In Berlin hat der Filz Tradition“, Tagesspiegel vom 20.03.2016,
(2) Vergl. hierzu auch den aufschlussreichen FAZ-Artikel „Monopoly am Kurfürstendamm: Sie bauen nichts, sie wollen nur Geld machen“ von Niklas Maak, 15.11.2024
(3) Alle Angaben auf Grundlage der Artikel:“ Politische Affären und Skandale: In Berlin hat der Filz Tradition“ von Werner van Bebber, Tagesspiegel vom 20.3.2016 und „Berlin: „Sumpfiges Ende einer Ära“, Von Lars von Törne, Tagesspiegel, 12.01.2006
(4) Alle Angabe auf Grundlage von: „Politische Affären und Skandale: In Berlin hat der Filz Tradition“, von Werner van Bebber, Tagesspiegel vom 20.03.2016, 10:52 Uhr
(5) Alle Angaben „Berliner Bankenskandal“, Wikipedia
(6) „Berlin am Tropf“, Spiegel, 24.02.1991, 13.00 Uhr •
(7) Alle Angaben lt. „Berliner Bankenskandal“ Wikipedia
(8) „Berliner Bankenskandal bleibt straffrei – “ von Sebastian Heiser, Tageszeitung vom 6.1.2015
(9) Alle Angabe auf Grundlage von: „Politische Affären und Skandale: In Berlin hat der Filz Tradition“, von Werner van Bebber, Tagesspiegel vom 20.03.2016
(10) „Licht in den Berliner Sumpf: Polizei soll Lagebild zur Korruption liefern“ von Alexander Fröhlich, Tagesspiegel vom 03.12.2022
(11) ebenda
(12) Angaben basieren auf dem Artikel: „Stadtplanung: OVG für Verdichtung Berlins“, von Reinhart Bünger, Tagesspiegel 9.10.2020
10. Bürgerbeteiligung
VORSICHT VOR MOGELPACKUNGEN
Bürgerbeteiligung in Berlin: Anspruch, Realität und Missbrauch
1. Der Große Tiergarten – Symbol und Warnung
Der Große Tiergarten in Berlin, ein bedeutendes Gartendenkmal und Rückzugsort für Mensch und Natur, ist trotz seines Schutzstatus nicht dauerhaft vor Bebauung sicher. Der Denkmalschutz kann entzogen werden – rechtlich und politisch ist dies möglich. Die kritische Frage bleibt: Ist die Aussage „Niemand hat die Absicht, den Großen Tiergarten zu bebauen“ glaubwürdig?
2. Bürgerbeteiligung: Anspruch vs. Wirklichkeit
Beteiligung ist in Berlin oft einseitige Information statt echter Mitbestimmung. Bürger*innen fühlen sich instrumentalisiert – vor allem bei Großprojekten. Kritik und Expertise werden häufig ignoriert oder als störend empfunden. Beispielhaft zeigt sich das im schleichenden Übergang von echter Beteiligung zur „Akzeptanzbeschaffung“.
3. Positivbeispiel: Bürgerdialog Berliner Mitte
2016 brachte der Dialog „Alte Mitte – Neue Liebe“ ein vorbildliches Ergebnis: Der grüne Freiraum zwischen Fernsehturm und Humboldt Forum sollte erhalten bleiben. Dieser Konsens wurde politisch übernommen und planerisch umgesetzt. Der Wettbewerbssieger, das Büro RMP Stephan Lenzen, setzte die Bürgerideen konsequent um – ein Meilenstein für Beteiligung auf Augenhöhe.
4. Molkenmarkt: Von Transparenz zur Manipulation
Zunächst als Beteiligungserfolg gefeiert, kippte das Projekt Molkenmarkt in einen massiven Skandal:
- Verzögerung der Jurysitzung: Angeblich krankheitsbedingt verschoben – Zweifel an der Unabhängigkeit kamen auf.
- Fälschung von Dokumenten: Hinweise auf Sieger wurden aus den Juryunterlagen entfernt – ohne Sanktionen.
- Keine Prämierung, nur Empfehlungen: Die Jury durfte keinen Entwurf küren, was viele Beteiligte als Vertrauensbruch werteten.
- Politische Einflussnahme: Die Nähe zwischen Senatsbaudirektorin Kahlfeldt und konservativen Architekten wie Albers oder Mäckler wirft Fragen auf.
- Gestaltungshandbuch an Mäckler Architekten vergeben, obwohl diese sich nicht beworben hatten – ein Rückfall in den „Berliner Sumpf“.
5. Tempelhofer Feld: Wiederholung eines Musters
Seit dem Volksentscheid 2014 ist das Tempelhofer Feld vor Bebauung geschützt. Doch auch hier versucht der Senat erneut, über „Dialogwerkstätten“ Akzeptanz für Bebauung zu erzeugen:
- Ziel: Nicht das „Ob“, sondern das „Wie“ der Bebauung
- Intransparente Auswahl der Teilnehmenden, unklare Kriterien
- Zweite Werkstatt: Deutliche Ablehnung der Bebauung durch Teilnehmer*innen
- Dritte Werkstatt: Ernüchterung, Desillusionierung, Protest der Beteiligten – viele fühlen sich instrumentalisiert
Trotz klarer Ablehnung durch die Bürger*innen kündigt die CDU an, nur mit Bebauungsentwürfen weiterarbeiten zu wollen. Auch hier zeigt sich: Bürgerbeteiligung wird als Mittel zum Zweck genutzt, nicht als demokratischer Prozess.
Fazit:
Demokratie in Gefahr
Die Beispiele Molkenmarkt und Tempelhofer Feld zeigen deutlich: Bürgerbeteiligung in Berlin ist häufig eine Mogelpackung. Wenn politische Interessen dominieren und Ergebnisse „umgebogen“ werden, entsteht nicht nur ein Vertrauensverlust gegenüber der Verwaltung – sondern auch ein massiver Schaden für die Demokratie.
Lehren für die Zukunft:
- Echte Bürgerbeteiligung muss verbindlich und transparent sein.
- Politische Einflussnahme in Planungsverfahren zerstört Glaubwürdigkeit.
Beteiligung darf nicht nur Schein, sondern muss ernst gemeinte Mitentscheidung sein
BÜRGERBETEILIGUNG SCHRUMPFT ZUR AKZEPTANZBETEILIGUNG
(8(8(8Aus der Vergangenheit für Gegenwart und Zukunft lernen
„Niemand hat die Absicht, Grünanlagen zu bebauen!“ Wirklich niemand und niemals?
Zweifel an der Glaubwürdigkeit von Politik und Verwaltung kommen auf, wenn wir den Blick auf den Niedergang der Bürgerbeteiligung bei Großprojekten in Berlin richten. Wir stellen fest, dass bei vor allem bei Großprojekten die Bürgerbeteiligung zur Akzeptanzbeteiligung schrumpft und sogar die Expertise der Fachwelt noch Feigenblatt für Politik und Senatsverwaltung ist. Hier der spektakuläre Niedergang der „Bürgerbeteiligung bei Großprojekten“ während der letzten 10 Jahre:
Los geht’s! Berlin auf der Höhe der Zeit: Bürgerbeteiligung auf Augenhöhe
Gesetzlich vorgeschriebene Bürgerbeteiligungsverfahren im Städtebau sind ein mit viel Erfahrung angewendeter Standard. Die in dieser Form praktizierte Beteiligung geht jedoch häufig am Bürger vorbei. Denn gängige Praxis ist, dass bei der Planungsbeteiligung gemäß Baugesetzbuch keine „Beteiligung“ stattfindet, sondern lediglich eine einseitige Information. Die Anregungen der BürgerInnen, die sich ja in der Regel gegen die Planung wenden, werden seitens der Verwaltung überwiegend als Planungserschwernis betrachtet und routiniert „wegbewertet“.
Mit derartig verknöcherten Politikansätzen können die Probleme der Zukunft aber nicht mehr bewältigt werden.
Berlin hat die Herausforderungen, wie zunehmende Arbeitslosigkeit, Gegensätze zwischen armen und reichen, alten und jungen Menschen, solchen mit und ohne Migrationshintergrund, Wohnungsnot und Klimawandel, anfänglich sogar auch tatsächlich angenommen.
Ergebnis einer erfolgreichen intensiven Bürgerbeteiligung:
Die Neuplanung der Berliner Mitte zwischen Fernsehturm und Humboldtforum
Nach einer jahrelangen Kontroverse, ob die Berliner Mitte zwischen Fernsehturm und Humboldt Forum bebaut werden soll oder nicht, einigten sich die Teilnehmer:innen des Dialogprozess „Alte Mitte – Neue Liebe“ im Jahr 2016 auf 10 Bürgerleitlinien zur Bedeutung und Rolle der Berliner Mitte (1) . Eine Mehrheit aller Fraktionen im Abgeordnetenhaus übernahm die Ergebnisse des öffentlichen Bürgerdialogs und machte sich durch einen Beschluss im Juni 2016 das Ergebnis zu eigen. „der grüne Freiraum zwischen Fernsehturm und Humboldt Forum bleibt zu 100% erhalten und wird qualifiziert weiterentwickelt!“ Die Fraktionschefin der Grünen Antje Kapek begrüßte den Beschluss, den ihre Fraktion angeregt habe, weil „damit erstmals das Ergebnis eines Beteiligungsverfahrens zu 100 Prozent übernommen wurde (2)“. Den Wettbewerb zur Gestaltung des Freiraums gewann 2021 schließlich das Kölner Büro RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten. Dazu Prof. Klaus Overmeyer, Juryvorsitzender und Mitglied der Architektenkammer Berlin: „Die Entscheidung für den ausgewählten Entwurf ist ein Meilenstein für die Freiraumgestaltung der Berliner Mitte. Nach dem umfassenden Beteiligungs- und Planungsprozess übersetzt die Arbeit die komplexen Anforderungen an den Ort in einen klaren und verbindenden Freiraum, der Lust auf Zukunft macht und alle Chancen hat, zu einem Habitat für die Berliner Stadtgesellschaft des 21. Jahrhunderts zu werden (3)“.. Mit der Umsetzung der Siegerentwurfs wurde die landeseigene Gesellschaft GrünBerlin beauftragt.
Erster Spatenstich war am 23. Juni 2025. Dazu Christopher Schriner, Bezirksstadtrat im Bezirk Mitte von Berlin: „Die Neugestaltung des Rathaus- und Marx-Engels-Forums führt die jahrzehntelange Debatte über den Umgang mit der historischen Mitte Berlins zu einem versöhnlichen Abschluss. Die neue Gestaltung nimmt die Belange verschiedener Gruppen auf und schafft einen verbindenden Ort für Alle! Hier entsteht ein einzigartiger öffentlicher grüner Raum im Zentrum einer dicht besiedelten europäischen Stadt, der seinesgleichen sucht (4)“
Bebauung Molkenmarkt Teil I
Mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplans 1-14 „Molkenmarkt“ im Jahr 2016 wurde ein wichtiger Meilenstein in der Planung des neuen Quartiers Molkenmarkt in Berlin Mitte erreicht. Auch dieser Bebauungsplan war Ergebnis eines umfangreichen Planungsprozesses mit zahlreichen Planungswerkstätten und unter Einbindung der Öffentlichkeit.
„Neues Miteinander – Acht Leitlinien beschlossen!“
Unter dieser Überschrift verkündet die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen am 27. Mai 2021 das Vorliegen von Acht Leitlinien: „Seit Frühjahr 2021 bilden acht Leitlinien die Vision zum Molkenmarkt. Gemeinsam mit der Stadtgesellschaft, internationalen Expert:innen, Akteur:innen vor Ort, künftigen Bauherr:innen und den Partner:innen in Verwaltungen und Institutionen wird derzeit die städtebauliche Qualifizierung durchgeführt. Im Rahmen der ersten Phase – der Sondierungsphase – kamen die Partner:innen des Projekts digital zusammen, um gemeinsam eine Antwort darauf zu finden, wie das Quartier am Molkenmarkt atmosphärisch, vielfältig, öffentlich und zukunftsfähig gestaltet werden kann. Acht Leitlinien für die Quartiersentwicklung wurden dabei verfasst (5)“. Die Leitlinien zum Molkenmarkt sollten die Basis für das Wettbewerbs- und Werkstattverfahren bilden.
Von der Bürgerbeteiligung zur Mogelpackung
Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeldt torpediert das Wettbewerbs- und Werkstattverfahren
Das Auftaktkolloquium für die Erarbeitung der Architekturentwürfe fand am 20. Januar 2022 statt, das erste Werkstattgespräch am 3. Februar 2022. Die Abgabe der Planungsentwürfe für den Molkenmarkt erfolgte dann am 2022. Im Zwischenkolloquium zeichnete sich bereits eine Mehrheit der Jury für den Entwurf des Kopenhagener Architekturbüro OS arkitekter i. V. m. den Berliner Architekten Marek Czborra und Tom Klingbeil ab. Mit ihren Entwürfen verwirklichten sie allem Anschein nach die Vorgabe „bezahlbarer, vielfältiger Wohnraum in klimaschonenden und resilienten Gebäuden“.
Die Abschlusspräsentation mit Prämierung des Siegerentwurfs sollte am 23.7.2022 stattfinden. Bis dahin hatte es auch der eher konservative Entwurf der Berliner Architekten Bernd Albers und Silvia Malcovati geschafft: kleinteilige Parzellierung der Grundstücke, Herstellung einer altstadtähnlichen Atmosphäre, wenig Grünflächen. Die Senatsverwaltung favorisiere den Entwurf vom Büro Albers/Malcovati. Dazu muss man wissen: Dem verstorbenen Architekten Bernd Albers steht die Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeldt biografisch nahe. Beide haben sie an der neuen „Altstadt“ in Frankfurt am Main mitgewirkt; beide waren sie über Jahre Teil der Berliner „Planungsgruppe Stadtkern“, die für eine „Wiedergewinnung der Berliner Mitte“ eintritt (6).
1. Schritt: 23. Juli 2022 – Die Jurysitzung wird verschoben
Am 23.7.2022 wird die Jurysitzung überraschend „auf einen Termin nach den Sommerferien“ verschoben letztlich auf den 22. September 2022. Die Absage einer solchen Jurysitzung ist äußerst unüblich, zumal die Mitglieder des Preisgerichts Stellvertreter haben und der Termin schon seit geraumer Zeit feststeht. Wer die Personen sind, die nicht an der Sitzung teilnehmen können, wollte die Senatsverwaltung damals auf Nachfrage des Tagesspiegels nicht mitteilen. Tatsächlich wurde bekannt, dass die Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeldt seit längerem erkrank sei. Was würde es also bedeuten, wenn die abschließende Jurysitzung nun deshalb verschoben wird, weil Petra Kahlfeldt aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen kann? Ist die Senatsverwaltung besorgt, dass die Jury sich ohne Petra Kahlfeldts Teilnahme für den „falschen“ Entwurf entscheidet? Versucht sie, die Beteiligung von Jury und Öffentlichkeit zu umgehen, um den von ihr favorisierten Entwurf durchzubekommen (7)?
2. Schritt: 9. September – 2022 Die Auslobungsunterlagen werden gefälscht.
Am 9. 9. 2022, werden die Auslobungsunterlagen der Jury gefälscht: „Kurz vor dem Abschlusskolloquium des Preisgerichts am 13. September 2022 ließ die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung alle Hinweise auf eine Entscheidung und einen Gewinner aus den maßgeblichen Dokumenten entfernen. Die Aktion ist einer internen E-Mail eines Mitarbeiters der Stadtentwicklungsverwaltung zu entnehmen, die am Freitag, dem 9. September 2022, um 12.27 Uhr verschickt wurde. In der E-Mail heißt es: „Liebes Projektteam Molkenmarkt, wie in unserer Besprechung heute Morgen besprochen, sende ich Ihnen die überarbeiteten Dokumente für das Abschlusskolloquium und die Pressekonferenz. Alle Hinweise auf ‚Entscheidungen‘ und ‚Gewinner‘ wurden entfernt und durchgehend in ‚Empfehlungen‘ geändert. Der Übersichtlichkeit halber ist alles in einem Dokument zusammengefasst und mit Trennblättern versehen, welche die Änderungen aufführen und die Zielgruppe benennen.“ Das Schreiben ist an sechs Personen aus der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung gerichtet, darunter Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeldt und Manfred Kühne, Leiter der Abteilung II für Städtebau und Projekte. Die E-Mail liegt der Berliner Zeitung vor. Den Vorgang konnte die Berliner Zeitung erst am 6. November 2023 nach umfangreichen Recherchen im Zuge einer Akteneinsicht nach dem Informationsfreiheitsgesetz veröffentlicht.“ (8)
Mit dieser Aktion schwenkt das Projekt „Molkenmarkt“ wieder in den Berliner Sumpf ein, weg von der Zivilgesellschaft und der parlamentarischen Kontrolle.
3. Schritt: 13. September 2022 – Es gibt keine Sieger nur Empfehlungen.
Mit dem neuen Narrativ, also nach dieser Fälschung, findet die Abschlusssitzung der Jury am 13. September statt und geht – natürlich – mit einem Paukenschlag zu Ende: „Entgegen der Ankündigungen und der Auslobung wird in der Sitzung keiner der beiden städtebaulichen Entwürfe prämiert, um als Grundlage der weiteren Planungen und der anstehenden Hochbauwettbewerbe zu dienen. Stattdessen werden lediglich Empfehlungen für die Ausarbeitung einer „Charta Molkenmarkt“ verschriftlicht. (9)
Senatsbaudirektorin Kahlfeldt behauptet anschließend, es habe nie im Raum gestanden, einen einzigen Entwurf zu küren. Wie der Tagesspiegel erfuhr, waren allerdings auch die Jurymitglieder in der Sitzung von der Behauptung überrumpelt worden, dass kein Entwurf prämiert werden solle.
„Frau Kahlfeldt hat das intensive und teure Werkstattverfahren offenbar bewusst an die Wand gefahren“, sagte Linke-Politikerin Gennburg dem Tagesspiegel zu den hohen Kosten von 779.000€. Die Senatsbaudirektorin trage damit die Verantwortung für einen schweren Vertrauensschaden in den Bau- und Planungsstandort Berlin und befördere Demokratieverdrossenheit bei denjenigen Bürgern, die sich über Jahre am Planungsprozess beteiligt hätten. (10)
Auch in der Architektenschaft äußert sich Unmut über den überraschenden Ausgang des Verfahrens ohne einen klaren Sieger. Beim ersten „Stadtgespräch“ mit Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeldt, das der Bund deutscher Architektinnen und Architekten am Dienstagabend ausrichtete, beklagte ein teilnehmender Architekt den „Vertrauensbruch“, der stattgefunden habe: „Kern- und Grundsätze der Beteiligung sind, dass man nicht die mit dem Bürgerdialog abgestimmten Prozesse über Bord schmeißt, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen.“ Der Ausgang des Werkstattverfahrens habe nun die gesamte Initiativenlandschaft in Aufregung versetzt. (11)
Dazu Petra Kahlfeldt: „Meine Sorge bei dem ganzen Eklat um den Molkenmarkt ist, dass auf einmal das Wettbewerbswesen in ein furchtbares Licht kommt, wenn es in Berlin möglich wäre, dass irgendjemand sagt: Das da, das machen wir jetzt nicht, und die Kriterien wenden wir jetzt hier nicht an.“ (12) Von der Manipulation der Auslobungsunterklagen – kein Wort.
November 2023 Die Fälschungen werden von der Berliner Zeitung veröffentlicht. (13)
Am 6.11. 2023 veröffentlicht die Berliner Zeitung nach umfangreichen Recherchen im Zuge einer Akteneinsicht nach dem Informationsfreiheitsgesetz die Fälschungen der Juryunterlagen durch die Senatsverwaltung. (14)
Seltsam ist, dass diesen Fälschungen der Juryunterlagen keine Sanktionen folgten. „Man kennt sich, man hilft sich!“ und die Karawane zieht weiter mit der Senatsbaudirektorin Kahlefeldt als Karawanenführerin.
Von der Mogelpackung zurück in den Berliner Sumpf
Molkenmarkt Teil II
Nach der abgesagten Prämierung eines Siegerentwurfs nun die Empfehlungen für die Ausarbeitung einer „Charta Molkenmarkt“. Dass die Charta entstehen soll, war schon lange klar. Nur: Wie genau sollen sich die Ergebnisse von Werkstattverfahren und Leitlinien darin niederschlagen? Vermutlich ging es bei der Entscheidung der Senatsverwaltung, eine Charta Molkenmarkt zu erarbeiten, eher darum, Zeit zu gewinnen, bis neue politische Mehrheiten den Weg zum Umsteuern auf dem Molkenmarkt frei machen.
4. Schritt: 12. Februar2023 Der Architekten und Ingenieurverein (AIV e.V.) beteiligt sich an den Koalitionsverhandlungen
Nach den Wahlen zum Abgeordnetenhaus am 12. Februar 2023 bestimmt der Koalitionsvertrag zwischen CDU-SPD – unter Mitwirkung vom Vorsitzenden des Architekten und Ingenieurvereins e.V. Tobis Nöfer, Architekt, zur Bebauung des Molkenmarkt und anderswo folgendes: „Die Koalition hält daran fest, grundsätzlich keine landeseigenen Grundstücke oder Wohnungen zu verkaufen. Hiervon darf bei gemeinwohlorientierten Wohnungsbaugenossenschaften im Einzelfall abgewichen werden. Mit dem Ziel der Durchmischung bei größeren Quartiersentwicklungen auf landeseigenen Grundstücken sollen Genossenschaften in angemessener Weise bei der Vergabe von Flächen berücksichtigt werden. Die Vergabe kann durch Erwerb oder im Wege eines Erbbaurechts mit langfristiger Mietpreis- und Belegungsbindung erfolgen. Hierbei kann ein vereinfachtes Konzeptverfahren angewandt werden, wenn die soziale Bindung grundbuchrechtlich gesichert wird. Dabei werden die stadt- und wohnungspolitischen Ziele des Landes ebenso wie die Rückführung in Landesbesitz bei Auflösung der Genossenschaft, vertragswidriger Nutzung oder Veräußerungsabsicht gesichert.“ (15)
20. April 2023 Die AIV e.V. wird eine Genossenschaft gegründet.
Am Abend des 20.4. 2023 findet ein Treffen in den Räumlichkeiten des Architekten- und Ingenieurvereins zu Berlin-Brandenburg e.V. (AIV) in der Charlottenburger Bleibtreustraße statt. „Anwesend sind etwa 40 Personen. Tobias Nöfer, Vorsitzender des Vereins, hat Wichtiges zu berichten, es geht um die Gründung einer Baugenossenschaft, die der AIV anstoßen will. Stolz habe Nöfer berichtet, dass er bei den schwarz-roten Koalitionsverhandlungen beratend tätig gewesen sei. In den nächsten Jahren würden laut Koalitionsvereinbarung voraussichtlich viele landeseigene Grundstücke vergeben. Die AIV-Genossenschaft hoffe dann aufgrund ihrer guten Konzepte, viele dieser Grundstücke zu bekommen. Die Gründung der AIV-Genossenschaft solle schnell erfolgen, damit die Genossenschaft bereitstehe, sobald Grundstücke vergeben würden. Der Tagesspiegel selbst war nicht Zeuge bei der Veranstaltung. Einer der Teilnehmer hat der Redaktion aber eidesstattlich versichert, dass diese Aussagen der Wahrheit entsprechen.“ (16)
9. September 2023 Der Senat (nicht das Abgeordnetenhaus) beschließt den „Rahmenplan Molkenmarkt“.
Dort heißt es: „Die Empfehlungen (Dank der Manipulation seitens der Senatsverwaltung, siehe oben) aus dem Werkstattverfahren werden in dem Rahmenplan der Charta Molkenmarkt durch die Befassung im Senat von Berlin festgeschrieben. Anschließend werden diese in einem Gestaltungshandbuch Molkenmarkt vertiefend in den Blöcken ausformuliert und als Grundlage und für die anschließenden Hochbau- und Freiraumwettbewerbe sowie die erforderlichen vertraglichen Regelungen zwischen dem Land Berlin und den Akteuren genutzt. Aus dem Koalitionsvertrag 2023 zwischen CDU und SPD geht die folgende Absichtserklärung hervor: „Im neuen Quartier am Molkenmarkt streben wir die Errichtung von bezahlbarem Wohnraum, eine nachhaltige und gute Architektur, kleinteilige Strukturen und eine vielfältige Nutzung an. Dies werden wir mit den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften (LWU) und gemeinwohlorientierten Bauherren realisieren“ (CDU, SPD 2023:). Die folgende Beschreibung des Rahmenplans zur Charta Molkenmarkt zeigt die Schritte zur Umsetzung der Festlegung des Koalitionsvertrages auf.“ (17)
6. November 2023 – Wie viel bezahlbares Wohnen?
Am 6.1.2023 bekräftigt Bausenator Gaebler in der Stadtentwicklungsausschuss des Abgeordnetenhauses bezüglich der Bebauung des Molkenmarkts „Dort, wo die landeseigenen Wohnbaugesellschaften tätig sind, ist keine kleinteilige Bebauung vorgesehen.“ (18) Kahlefeldt, die die Fragen der Abgeordneten womöglich anders beantwortet hätte, war – mal wieder – nicht da. Die Bezahlbarkeit sei wichtig. „Es geht nicht um eine kleine Parzellierung“, sagte Gaebler nun. „Das würde ja auch wenig Sinn machen: Es gibt jeweils einen Eigentümer an der Stelle, die WBM und die Degewo.“ Es wird keine Vergabe an andere geben, ergänzte Bausenator Gaebler. Die Kleinteiligkeit werde über die Fassadengestaltung hergestellt“(19) Bleibt die Frage, was „an anderer Stelle“ geplant ist, auch mit Blick in den Koalitionsvertrag. Dazu hätten die Abgeordneten gerne Kahlefeldt befragt. Die aber fehlte, siehe oben.
Nach der Charta Molkenmarkt soll nun zusätzlich ein Gestaltungshandbuch für die abschließenden Architekturentwürfe erarbeitet werden. Zentrale Fragen, wie die Umrisse der Gebäude und die Grundstückparzellierung, sind nämlich noch offen und dürften wohl durch das Gestaltungshandbuch definiert werden.
Juni 2024 Grüße aus dem Berliner Sumpf.
Mit der Erarbeitung des Gestaltungshandbuch wird nicht das Büro beauftragt, welches sich dafür beworben hatte, nämlich das Kopenhagener Büro OS arkitekter, dessen Planungsentwurf von der Jury 2022 große Zustimmung erfuhr.
Die Erarbeitung des Gestaltungshand ging vielmehr an das Büro Mäckler Architekten, Frankfurt a.M., das sich auf Anfrage des Tagesspiegel nicht beworben hatte. „Naheliegend für die Entscheidung ist, dass Senatsbaudirektorin Kahlfeldt Christoph Mäckler aus der gemeinsamen Arbeit im Gestaltungsbeirat für die Frankfurter ‚neue Altstadt‘ kennt. Während Mäckler Vorsitzender des Gremiums war, saß Architektin Kahlfeldt, damals noch nicht Senatsbaudirektorin, als nicht stimmberechtigtes Mitglied in dem Gremium. Als Aufgabe formulierte Mäckler damals in einem Interview mit der Frankfurter Neuen Presse, ‚dass sich die bauliche Erneuerung des Areals der historischen Struktur der Altstadt unterordnet‘. Die ‚neue Frankfurter Altstadt‘ könne so auch zum Vorbild für andere neue Stadtquartiere werden. Als wenig vorbildhaft dürften aber die Kosten des Gesamtprojekts werden: Die notwendigen Investitionen der Stadt Frankfurt stiegen auf mehr als 200 Millionen Euro an, wovon 90 Millionen als Defizit am kommunalen Haushalt hängenblieben. Kurz nach der Eröffnung im Mai 2018 kostete die Miete der teuersten der neuen Wohnungen 33 Euro auf den Quadratmeter. Nicht nur über den Frankfurter Gestaltungsbeirat gibt es Verbindungen zwischen dem Architekturbüro des Ehepaars Kahlfeldt, das seit dem Amtsantritt von Petra Kahlfeldt von ihrem Mann allein weitergeführt wird, und dem Büro Mäckler Architekten: Eine von fünf Geschäftsführer:innen des Büros Mäckler Architekten ist Christiane Will, die vor ihrem Wechsel zu Mäckler für das Architekturbüro der Kahlefeldts in Berlin arbeitete.“ (20)
Von der Akzeptanzbeschaffung zur „Desinteressen-Bekundung“
Der Senat würde auf dem Tempelhofer Feld gerne seit 2011 bauen. Eine Randbebauung soll es sein! Vorwiegend Wohnungsbau. Was ihn daran hindert ist das Ergebnis des Volksentscheids vom Mai 2014. Danach soll das Tempelhofer Feld inmitten der dichtbebauten Stadt als riesige Grünfläche in mitten der Stadt erhalten bleiben – für Naturerfahrung, Erholung, Sport und Freizeit. Die immer wieder aufbrechende Diskussion über eine künftige Nutzung sollte nun mit Dialogwerkstätten in eine neue Phase gehen und zwar in Richtung Bebauung. Deshalb sollte es nach Meinung des Senators für Stadtentwicklung und Wohnen nicht um das „Ob“ gehen, sondern nur um das „Wie“. (21)
Dialogwerkstätten zur Bebauung des Tempelhofer Felds und int. Ideenwettbewerb
Die Senatsverwaltung hat in der Konzeption der Dialogwerkstätten aus dem Planungsverfahren zum Molkienmarkt gelernt und Schlüsse gezogen: Die Bürgerbeteiligung zur Zukunft des Tempelhofer Felds „sei ein Dialogprozess, es ist kein Beteiligungsformat, an dessen Ende eine Entscheidung steht, sagte Bausenator Gaebler. (22)
Der Ansatz sei, mit einer Gruppe von 250 zufällig ausgewählten Bürger:innen, die etwa repräsentativ für die Zusammensetzung der Berliner Bevölkerung sei, zu diskutieren. Sie sollen der Senatsverwaltung zufolge Thesen für eine Entwicklung des Tempelhofer Felds aufstellen. Ihre Einschätzungen sind nicht bindend. Die Ergebnisse sollen aber in die Aufgabenstellung des geplanten internationalen stadt- und freiraumplanerischen Ideenwettbewerb einfließen.“ (23)
An Kritik im Vorfeld der Veranstaltungsreihe fehlt es nicht. „Es werde versucht, ein Konzept auf den Weg zu bringen, das keine Lösung ermögliche außer die Erfüllung der Ideen der Initiatoren.“ (24)
„Wie aber genau die „gewichtete Zufallsauswahl“ der Teilnehmenden aussieht, bleibt intransparent: Unklar ist, nach welchen Kriterien sichergestellt werden soll, dass ein Querschnitt der Stadtgesellschaft abgebildet wird. Wird auch geschaut, dass diejenigen mit besonders beengtem Wohnraum berücksichtigt sind, proportional zu ihrem Anteil in der Bevölkerung? Fragen nach der Gewichtung bei der Auswahl beantwortet der Senat so gut wie nicht.
Dabei hat allein der angrenzende Stadtteil Kreuzberg 61 – nach dem alten Postzustellbezirk – mit knapp 65.000 Einwohnern eine Bevölkerung ungefähr so groß wie die Stadt Weimar, aber nur ein gutes Zwanzigstel von deren Fläche. Beengter Wohnraum dürfte hier also, genau wie im Schillerkiez und im restlichen Neukölln, ein Thema sein. Zwar soll laut Senat sichergestellt sein, dass die Bewohner der angrenzenden Kieze repräsentiert sind. Doch wie genau bleibt ebenso unklar wie die Frage, ob Menschen mit prekären Wohnverhältnissen, die auf die Freiheit des Feldes besonders angewiesen sind, ebenfalls explizit berücksichtigt werden. Wenn schon, dann müsste auch eine solche Repräsentation das Ziel eines „gewichteten Zufallsverfahrens“ sein.
Diese Intransparenz nährt den Verdacht, dass der Senat lieber sicherstellen will, dass Bewohner möglichst vieler Bezirke zu Wort kommen: Menschen aus Stadtteilen, die das Tempelhofer Feld weniger als Freizeitort nutzen, sondern es eher für eine windige Freifläche halten, die eine Randbebauung durchaus vertragen könnte.
Dabei müsste es gerade bei einer so sensiblen Frage wie dem Umgang mit einem per Volksentscheid beschlossenen Gesetz mit maximaler Transparenz und einem wirklich offenen Verfahren zugehen, um jeden Anschein einer gesteuerten Beteiligung mit eigentlich schon festgelegtem Ziel zu zerstreuen.
Immerhin: Dass die Senatsverwaltung sich mit der eigenen Beteiligung in der Jury für den internationalen Ideenwettbewerb zurückhalten und stattdessen Menschen aus den Dialogwerkstätten den Vortritt geben will, zeigt, dass ein wenig Sensibilität für diese Fragen durchaus vorhanden ist. Das reicht aber nicht: Das Beteiligungsverfahren wirkt eben nicht ergebnisoffen, sondern so, als stünde das Ziel einer Bebauung schon fest.“ (25)
Wie also würden sich die TeilnehmerInnen entscheiden? Würde es zu einer einheitlichen Willensbekundung der TeilnehmerInnen kommen?
Die erste Dialogwerkstatt fand am 7. und 8. September 2024 statt. Die TeilnehmerInnen lernt das Flughafengebäude am Platz der Luftbrücke kennen und wurden eingeführt in die bewegte 1000jährige Geschichte dieses historischen Geländes. Außerdem gibt es mehrere Kurzreferate etwa zur Stadtentwicklung, zum Klimaschutz in Berlin und zu den Ergebnissen eines Workshops mit knapp 200 Kindern und Jugendlichen, die sich mit dem Tempelhofer Feld beschäftigt hatten.
Die zweite Dialogwerkstatt fand am 21. und 22. September statt. Das Ergebnis: „Eine deutliche Mehrheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Dialogwerkstatt zur Zukunft des Tempelhofer Feldes hat sich gegen eine Randbebauung des Feldes ausgesprochen. Stattdessen favorisierten die meisten eine Weiterentwicklung der verschiedenen Nutzungen wie etwa Kultur-, Bildungs- und Sportangebote. Von zehn sogenannten Entwicklungsperspektiven für das Feld, die von den Teilnehmern die meiste Unterstützung erhielten, sieht keine eine Randbebauung vor. In fünf Kleingruppen sollten sie sogenannte Entwicklungsperspektiven für das Tempelhofer Feld erarbeiten. Die zwei von den Kleingruppen jeweils am höchsten gewichteten Entwicklungsperspektiven wurden am Ende im Gesamtplenum vorgestellt und von diesem nochmals gewichtet. Keine der vorgestellten Perspektiven sprach sich für eine Randbebauung des Feldes mit Wohnungen aus. Sie unterschieden sich nur in Nuancen, je nachdem wie viel Bedeutung sie dem Feld für welche Nutzung beimaßen. Die meisten Stimmen aus dem Gesamtplenum erhielt die Entwicklungsperspektive mit dem Titel „Bewahrung der weltweit einzigartigen Perle im Herzen Berlins“. Als zentral Punkte wurden genannt: „keine Bebauung“, „Förderung und Ausbau des Bestehenden“ sowie „THF für alle“. Besonders hervorgehoben wurde die Bedeutung des Felds für den Naturschutz, den Klimaschutz und die Klimaanpassung.“ (26). Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD) bedankte sich am Ende der Veranstaltung schmallippig bei allen Teilnehmenden und stellte fest, dass die Teilnehmenden und die Senatsverwaltung darin übereinstimmen, „das Feld zu entwickeln“. So kann man das auch ausdrücken.
Der internationale Ideenwettbewerb begann Ende 2024, in den die Ergebnisse aus den Dialogwerkstätten einfließen sollten. Wie bereits beim Molkenmarkt wurde von der Verwaltung mitgeteilt, dass es nicht nur einen Sieger geben werde. Auch solle über die Ergebnisse nochmal in einer dritten Dialogwerkstatt diskutiert werden – und in einem Abschlussbericht und einer Ausstellung einer größeren Öffentlichkeit vorgestellt werden. Grundsätzlich geht es in dem gesamten Verfahren nicht darum, eine Entscheidung zu treffen. „Es wird nicht die Werkstatt und auch nicht der Ideenwettbewerb entscheiden“, so Bausenator Gaebler im vergangenen Dezember 2023 klargestellt. (27)
Im Juni 2025 wählte das Preisgericht eine Auswahl an Siegern. Die Jury des Ideenwettbewerbs zeichnete vier Entwürfe ohne und zwei Entwürfe mit Bebauung aus. Daraufhin kündigte die CDU an. nur mit den beiden Entwürfen, die eine Bebauung vorsehen, weiterarbeiten zu wollen.
Am 12. Und 13. Juli wurde die dritte Dialogwerkstatt durchgeführt „Wie Teilnehmende dem Tagesspiegel berichten, gab es am Sonntagmorgen außerplanmäßig eine längere Diskussion, warum die Dialogwerkstatt überhaupt noch zusammenkomme, wenn die Entscheidung des Senats doch sowieso schon gefallen sei. Viele fühlten sich „veräppelt“, sagte ein Teilnehmer. Offenbar waren ohnehin nur noch gut 100 der 275 ausgewählten Berliner:innen gekommen. Neben vereinzelten Teilnehmer:innen, die sich für eine Bebauung aussprachen, verfasste eine größere Gruppe ein Proteststatement: „Wir befürchten, dass unser Engagement im Dialogprozess dazu missbraucht wird, um eine Bürgerbeteiligung vorzutäuschen“, so die Gruppe. „Wir möchten, dass die Ablehnung der Bebauung und der Erhalt des Tempelhofer Feld-Gesetzes durch die Mehrheit der Teilnehmenden in diesem hoch kontroversen und potenziell den sozialen Frieden der Stadt gefährdenden Prozess anerkannt wird.“ (28)
„Aus dem Kreis der Dialogwerkstätten war die Hälfte der Jury des Ideenwettbewerbs besetzt worden. Auch in dieser Gruppe ist der Unmut groß, wie einige von ihnen dem Tagesspiegel mitteilten: „An vielen Stellen, nicht nur durch die öffentlichen Äußerungen, sondern eben auch bei der Prozessgestaltung, den Fragestellungen an die Dialogwerkstätten und der Sprache der Auslobung, wurde das bekannte Ansinnen der politischen Entscheider in der Senatsverwaltung und dem AGH sehr deutlich, die Frage der Bebauung auf dem Tempelhofer Feld zu forcieren.“ (29)
Senator Christian Gaebler (SPD) bekundete sein Desinteresse, indem er erst am Sonntagnachmittag gegen Ende vorbeikam. Abgeordnete – selbst die, die eigens angefragt hatten – waren nach Tagesspiegel-Informationen nicht zur Veranstaltung zugelassen. (30)
Auch nicht beteiligt war Tobias Nöfer, Architekt und Vorsitzenden des Architekten- und Ingenieurvereins zu Berlin-Brandenburg. Er hatte sich bereits an den Koalitionsverhandlungen von CDU und SPD erfolgreich beteiligt und lässt der Berliner Zeitung schon drei Tage vor Veröffentlichung des CDU-SPD- Koalitionsvertrag wissen: „Ihm sei vor allem eine offene Diskussion wichtig. „Aus meiner Sicht ist das Feld, so wie es jetzt ist, nicht optimal“, sagt er am Telefon. „Wir haben da Tundra, eine Fläche, die für einen Flughafen plattgemacht wurde.“ Ökologisch sei noch eine Menge herauszuholen. Auch er spricht sich für eine Randbebauung aus. Man könne aber auch die Frage stellen: „Muss man die Mitte des Feldes überhaupt freilassen?“ Es gäbe auch Vorschläge, das Feld komplett zu bebauen und hier und da kleinere Parks einzustreuen.“ (31)
Statt Bürgervoten zu respektieren weiterhin täuschen und tricksen
Zum Spitzenkandidat der SPD wurde am 31. August der Regionalpräsident der Region Hannover Steffen Krach gewählt. Wie schaut er auf Bürgerbeteiligung?
Volksentscheid „Deutsche Wohnen“
Auf die Frage, ob große Wohnungsgesellschaften in Berlin vergesellschaftet werden sollten, so wie es der erfolgreiche Volksentscheid „Deutsche Wohnen enteignet“ vorsieht, erklärt dieser: „KEIN Unternehmen muss Angst haben, enteignet zu werden.“ Die Antwort lautet also „Nein“!(32)
Volksentscheid „Tempelhofer Feld erhalten“
Auf die Frage, ob er sich an den Volksentscheid zum Tempelhofer Feld gebunden fühlt, erklärt dieser: „Ich kann beide Positionen verstehen“, sagte er. „Das ist ein wunderbarer Freiraum. Und es wäre falsch, das komplett aufzugeben. Jeder, der meine, mit der Randbebauung wäre das Wohnungsbauproblem in der Stadt gelöst, sei unehrlich zu den Menschen, betonte Krach. „Aber ich verschließe mich auch nicht der Diskussion, über Konzepte einer Randbebauung nachzudenken“, sagte er. Die Antwort lautet also auch hiersinngemäß: Der Volksentscheid zum Tempelhofer Feld hat für mich kaum Bedeutung. (33)
Mobilisierung von Baulandreserven
Kracht äußert sich auch zum Thema „Mobilisierung von Baulandreserven für den Wohnungsbau: Er sagt, dass wenn Investoren eine Baufläche über Jahrzehnte brachliegen lassen, nur weil sie damit am Ende höhere Gewinne erzielen, als wenn sie darauf bauen, der Staat eingreifen muss. Er könne sich auch nicht vorstellen, dass die Handwerkskammer oder die Industrie- und Handelskammer etwas dagegen haben, weil brachliegende Flächen in der Innenstadt auch für den Einzelhandel ein großes Problem sind. Auf Nachfrage des Tagesspiegel: „Das bedeutet als ultima ratio dann doch Vergesellschaftung?“ antwortet Krach: „Diese Flächen der breiten Gesellschaft wieder zur Verfügung zu stellen, finde ich richtig. Genauso wie das Ziel insgesamt, die Gesellschaft vor solchen Unternehmen zu schützen.“
Eine Vergesellschaftung von Brachflächen gehe aber völlig an der Realität vorbei, täusche aber darüber weg, dass im Gegensatz dazu der Volksentscheid „Deutsche wohnen“ für den SPD Spitzenkandidaten keine Bedeutung hat.
Fazit:
Eine Landesregierung, die den Volksentscheid zum Tempelhofer Feld von Beginn an torpediert, eine Landesregierung, die die Beteiligungsverfahren aushebelt wie am Molkenmarkt und sich öffentlich weigert, den Volksentscheid Enteignet Deutsche Wohnen umzusetzen, einer solchen Landesregierung ist auf jeden Fall zuzutrauen, auch Grünanlagen gewinnbringend zu verkaufen. Aus dieser Erfahrung heraus brauchen Grünanlagen jetzt ein Gesetz, das sie schützt.
(1) Quelle: Auswertungsbericht »Alte Mitte – neue Liebe?« Bürgerleitlinien für die Berliner Mitte /// Übersicht Bürgerleitlinien.
(2) Stadtplanung in Berlin: Beim Fernsehturm soll ‚ein Ort für alle‘ entstehen Von Ralf Schönball. Tagesspiegel 11.06.2016
(3) Veröffentlicht von Architektenkammer Berlin | erschienen am 13.09.2021.
(4) „Baustart am Rathaus- und Marx-Engels-Forum“, Pressemitteilung GrünBerlin vom 23. Juni 2025
(5) Quelle: https://molkenmarkt.berlin.de/2021/05/27/neues-miteinander-acht-leitlinien-beschlossen/
(6) „Zukunft des historischen Zentrums: Die große Hängepartie um den Berliner Molkenmarkt – Anfang Juli sollte ein städtebaulicher Entwurf für den Molkenmarkt gewählt werden. Doch die Sitzung wurde abgesagt. Kritiker sehen eine Trickserei des Senats.“ von Teresa Roelcke, Tagesspiegel vom 03.07.2022
(7) ebenda
(8) Architektur für den Molkenmarkt: „Auf die Bezeichnung Sieger verzichten – Trotz eines Architekten-Wettbewerbs ist unklar, wie der Molkenmarkt künftig aussehen soll. Warum werden die Entwürfe der Gewinner nicht umgesetzt?“ von Ulrich Paul, Berliner Zeitung vom 6.11.2023
(9) „Architektur für den Molkenmarkt: „Auf die Bezeichnung Sieger verzichten“ Trotz eines Architekten-Wettbewerbs ist unklar, wie der Molkenmarkt künftig aussehen soll. Warum werden die Entwürfe der Gewinner nicht umgesetzt? Von Ulrich Paul, Berliner Zeitung vom 06.11.2023 06:12 Uhr
(10) „Wettbewerb ohne Siegerentwurf: Berliner Molkenmarkt-Verfahren hat bislang fast 800.000 Euro gekostet“, von Teresa Roelcke, Tagesspiegel vom 13.10.2022, 13:01 Uhr
(11) ebenda
(12) ebenda
(13) Architektur für den Molkenmarkt: „Auf die Bezeichnung Sieger verzichten – Trotz eines Architekten-Wettbewerbs ist unklar, wie der Molkenmarkt künftig aussehen soll. Warum werden die Entwürfe der Gewinner nicht umgesetzt?“ von Ulrich Paul, Berliner Zeitung vom 6.11.2023
(14) ebenda
(15) Koalitionsvertrag Berliner CDU – SPD 2023 – 2026,, S. 52, Berlin 26. April 2023
(16) „Bauen in Premiumlage: Verdacht auf Lobbyismus bei Grundstückspolitik von Schwarz-Rot in Berlin“ von Teresa Roelcke, Tagesspiegel vom4.5.2023
(17) Molkenmarkt: „Rahmenplan – Erläuterungsbericht“, Seite 7, Senatsverwaltung Stadtentwicklung, Wohnen und Bauen, Berlin Oktober 2023
(18) „Günstige Wohnungen oder Edel-Quartier: Berlins Bausenator und seine Staatssekretärin ringen um den Molkenmarkt – Bausenator Christian Gaebler tritt am Molkenmarkt für bezahlbaren Wohnraum ein. Seine Senatsbaudirektorin will für den Altstadtcharakter kleinteilig bauen – was jedoch teurer wäre.“ von Teresa Roelcke, Tagesspiegel, Stand: 06.11.2023
(19) „Günstige Wohnungen oder Edel-Quartier: Berlins Bausenator und seine Staatssekretärin ringen um den Molkenmarkt“ von Teresa Roelcke, Tagesspiegel vom 06.11.2023
(20) Chef-Gestalter der Frankfurter „neuen Altstadt“: Er soll auch das Berliner Molkenquartier entwerfen“, von Teresa Roelcke, Tagespiegel vom 11.6.2024
(21) „Debatte um neuen Volksentscheid Senat nimmt Randbebauung des Tempelhofer Felds wieder ins Visier“ von Christoph Reinhardt rbb 24 vom Fr 24.05.24
(22) Debatte um Bebauung des Tempelhofer Feldes: „Ohne Rücksicht auf Verluste – Berlins Grüne kritisieren Bausenator“ Tagesspiegel vom 3.7.2024
(23) ebenda
(24) ebenda
(25) „Bebauungspläne für das Tempelhofer Feld: Die Bürger sind gefragt – aber der Senat hat die Antwort schon“ von Teresa Roelke, Tagesspiegel vom 26.5.2024
(26) „Dialogwerkstatt Tempelhofer Feld: Große Mehrheit lehnt Randbebauung ab – 150 Bürger debattierten am Wochenende zur Zukunft des Feldes. Ihr Votum ist eindeutig: Wohnungen sollen dort nicht entstehen. Die Grünen fordern, den nun geplanten Ideenwettbewerb zu stoppen.“ von Daniel Böldt, Tagesspiegel, 22.09.2024
(27) „Debatte um Tempelhofer Feld: Berliner Senat plant Bürgerwerkstatt zu möglicher Randbebauung
500 repräsentativ ausgewählte Bürger sollen über das „Wie“ einer Randbebauung des Tempelhofer Feldes debattieren. Anschließend ist ein Ideenwettbewerb geplant.“, von Daniel Böldt, Tagesspiegel, Stand: 05.12.2023, 18:33 Uhr
(28) Schon alles entschieden beim Tempelhofer Feld.“, von Teresa Roelcke, Tagesspiegel, 14.07.2025
(29) ebenda
(30) ebenda
(31) „Berlin debattiert: War es das mit der Freiheit auf dem Tempelhofer Feld?“ von Niklas Liebetrau, Berliner Zeitung vom 01.04.2023
100% Tiergarten e.V.
Stuttgarter Str. 48
12059 Berlin
